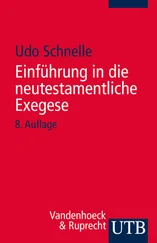Um das zu erfahren, müssen Sie wohl oder übel auch die anderen Kommentare lesen. In denen finden Sie nun aber einen Streit darüber, was der Autor Ihrer Einführung wohl mit einer seiner früheren Auslegungen gemeint habe. Plötzlich ist nicht mehr der Text von Kant thematisch, sondern ein Text über Kant. Man hat die Ebene gewechselt und befindet sich nun mitten in einem Forschungsdiskurs über diesen Text. Etwas ratlos fragen Sie bei einem befreundeten Philosophen nach. Er empfiehlt Ihnen, zu einem der beiden Autoren, die sich über Ihren Ursprungsautor streiten, eine weitere Einführung zu lesen. Sonst würde man nicht verstehen, aus welcher Perspektive er den Autor Ihrer ersten Einführung kritisiert. Sie lesen die Einführung und stoßen auf eine ganze philosophische Schule, auf die dieser zweite Autor zurückgreift. Es hilft nichts – um seine Perspektive zu verstehen, müssen Sie sich ausgiebiger mit dieser Schule beschäftigen. Sie müssen wieder die Ebene wechseln, von einem Text über den Text über Kant zu einem Text über diesen Text.
Auch wenn ich es etwas überspitzt dargestellt habe – der Weg zu Kants Text führt Sie, je weiter Sie ihn gehen, immer weiter weg von Kants Text. Es ist ein bisschen wie in Kafkas Erzählung Das Schloß : Je mehr Sie versuchen, zu der Ihnen versprochenen Weisheit zu gelangen, desto weiter entfernen Sie sich davon. Oder es ergeht Ihnen wie dem Mann in der Fabel aus Kafkas Erzählung Der Proceß : Hinter jedem Torwächter, den Sie überwinden, steht noch ein weiterer, mächtigerer Torwächter. Der Text, zu dem Sie zunächst so selbstverständlich als Leser oder Leserin gegriffen haben, wird nun umstellt von Kommentaren und Kommentaren zu diesen Kommentaren und Kommentaren, die die Verhältnisse zwischen den Kommentaren kommentieren usw. Und wer die wichtigsten Lehrautoritäten nicht kennt, wie will derjenige zur akademischen Forschung beitragen können?
Man kann natürlich versuchen, sich in diesem Diskurs einzurichten. Dafür muss man zunächst akzeptieren, dass es unmöglich ist, sämtliche Verzweigungen der Forschung auch nur zu einem einzigen Philosophen zu überblicken. Man sucht sich also eine Nische aus, in der man forschen kann, meist ein ausgefallenes Thema oder eine originelle Abwandlung einer anerkannten Herangehensweise. Was anerkannt ist, wird in vielen Fällen in den Expertendiskursen bekannter akademischer Lehrer festgelegt. Der Diskurs ordnet sich dann nicht selten nach Maßgabe akademischer Prominenz an. Und weil man zu Beginn weder anerkannter Experte, noch bekannter akademischer Lehrer ist, sucht man sich ein Gravitationszentrum, um das die eigene Forschung kreisen kann. Man passt sich an, schwimmt mit dem Strom und bleibt relevant.
Oder man scheidet aus dem Mainstream aus, vertritt eine abweichende Forschungsmeinung und versucht sein Glück als Querdenker. Es gibt viele Geschichten über solche Querdenker, die durch harte Arbeit, glückliche Fügung oder die Förderung durch einzelne berühmte Philosophen für den gesamten Forschungsdiskurs wichtig wurden. Die Zahl dieser Geschichten verhält sich umgekehrt proportional zu der Zahl derjenigen Querdenker, die tatsächlich auf nennenswerte Weise gefördert oder auch nur für relevant oder wichtig gehalten werden. Die vielen Anekdoten über glückliche Fügungen verbergen den Umstand, dass sie außerordentlich selten sind.
Erkennbar wiederholt sich hier das Problem vom Anfang. Entweder man wendet sich gleich von der Philosophie ab und erklärt sie für irrelevant. Oder man beruhigt die Krise, in die die Lektüre philosophischer Texte einen stürzen kann, durch die Anerkennung anerkannter Forschungsdiskurse, die einem außerdem akademischen Rückhalt verschaffen. Im ersten Fall setzt man die Selbstverständlichkeit des Alltäglichen gegen die Irritation der Philosophie. Im zweiten Fall setzt man die Selbstverständlichkeit der Meinungen über die Philosophie gegen die Irritation der – allerdings immer leiser werdenden – Frage, was das alles mit dem Text zu tun hat, über den doch alle streiten.
Philosophie als Einführung
Die vorliegende Einführung in die Philosophie versucht, dem Leser oder der Leserin einen dritten Weg neben den beiden skizzierten vorzuschlagen. Als Alternative ist er auch an die adressiert, die mit der Philosophie bereits abgeschlossen haben oder die sich mit ihr vom Boden einer philosophischen Schule aus auseinandersetzen. Aber vor allem soll diese Einführung ein Angebot sein für den Leser oder die Leserin, die noch vor dieser Entscheidung stehen: Sie haben die Lektüre Ihres ersten philosophischen Textes noch vor sich oder Sie sehen sich gerade vor das anfangs skizzierte Problem des Zugangs zu diesen Texten gestellt. Für diese Situation will die vorliegende Einführung eine Handreichung bieten.
Einführungen in das philosophische Denken gehören von Beginn an zur Philosophie dazu. Man könnte sogar sagen, dass die Philosophie selbst nichts anderes ist als eine Tradition von Texten, die in die Philosophie – d. h. in ihre Vorstellung von Philosophie – einführen wollen. In diesem Sinne hat derjenige, der eine solche Einführung schreibt, so scheint es, eine unmögliche Aufgabe zu erfüllen: Er möchte in etwas einführen, das er schon auf eine bestimmte Weise vorausgesetzt hat – er möchte in die Philosophie einführen und vertritt dabei selbst bereits eine philosophische Perspektive. 2
Wer eine Einführung in die Philosophie schreibt, der muss also eine Entscheidung treffen. Entweder führt er in die Philosophie auf eine Weise ein, die er dem Leser als eigene Perspektive anbietet: How I see philosophy . Das ebnet den Weg für Einführungen in die Philosophie, die ganz von einer beliebigen Philosophieauffassung des Autors der betreffenden Einführung abhängig sind. Sie führen nicht selten in den weiter oben skizzierten Forschungsdiskurs hinein, versuchen den Leser oder die Leserin für eine bestimmte Perspektive zu gewinnen und damit die eigene Relevanz zu erhöhen.
Doch eine solche Vorgehensweise gibt letztlich die eigene Verantwortung nur an den Leser oder die Leserin weiter. Wo diese eine Einführung in ein Fach, eine Disziplin, eine Denkweise erwarten, die sie bisher nur undeutlich unter dem Begriff »Philosophie« verstanden haben, wird ihnen eine Sichtweise auf die Philosophie präsentiert, zu der es potenziell unendlich viele Alternativen gibt. Wer solche Einführungen liest, der läuft Gefahr, sowohl die ungenannten Voraussetzungen, die stillen Überzeugungen, als auch die deutlich ausgesprochenen Meinungen über die Philosophie – und die Philosophen – vom Autor zu übernehmen. So ist es kein Wunder, dass wieder andere Einführungen in die Philosophie die philosophische Tradition in Denkschulen von Meinungen über Philosophie einteilen, deren weltanschauliche Auseinandersetzung bis heute andauert und tendenziell als unlösbar gilt. Die Vielfalt von Zugängen auf die Philosophie in den tradierten philosophischen Texten spiegelt sich in der Vielfalt der Zugänge auf diese Texte in der Einführungsliteratur. Was sich als Orientierungshilfe ausgibt, vervielfältigt die Pfade, die sich verzweigen, und lässt den Leser oft ratloser zurück als vorher.
Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, die vermeintlich unlösbare Aufgabe zu bewältigen, eine Einführung zu schreiben, die selbst einen philosophischen Standpunkt einnimmt. Anstatt einen bestimmten Philosophiebegriff als gegeben vorauszusetzen – und damit die Vorstellungen des Lesers von der Philosophie einschränkend vorzuprägen –, nimmt die vorliegende Einführung drei Vollzugsweisen in den Blick, die die philosophische Tradition insgesamt auszeichnen. Diese Vollzugsweisen sind so grundlegend, dass sie als Ausgangspunkt zunächst sogar banal erscheinen. Sie scheinen nicht recht zur Philosophie dazuzugehören, scheinen vielmehr zu denjenigen selbstverständlichen Voraussetzungen zu gehören, die man zu einem Philosophiestudium schon mitbringen muss. Die vorliegende Einführung wird sich bemühen, diese Vorstellung selbstverständlicher Voraussetzungen auf bestmögliche Weise philosophisch zu irritieren. Das tut sie, indem sie diese Voraussetzungen als philosophisches Problem betrachtet – und dabei ein Beispiel dafür gibt, was es überhaupt heißen kann, etwas als philosophisches Problem zu betrachten.
Читать дальше