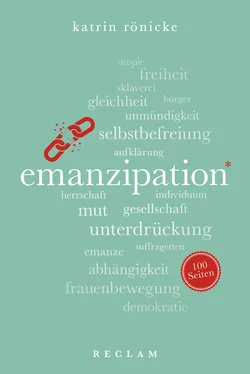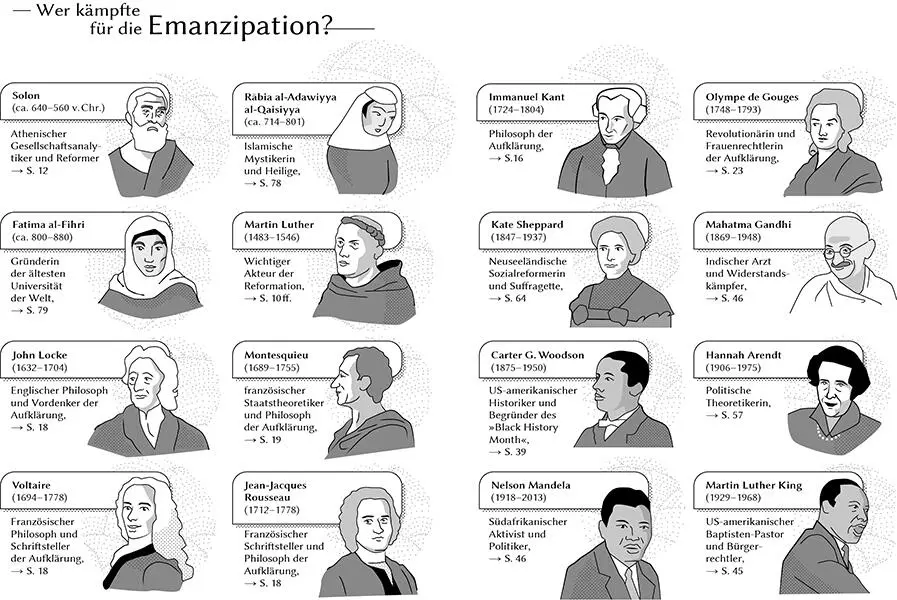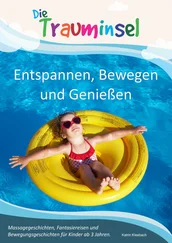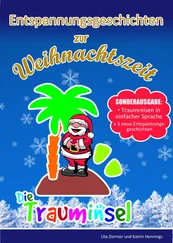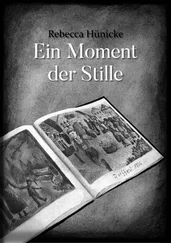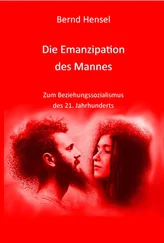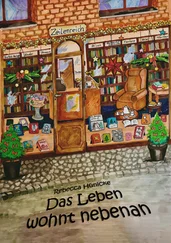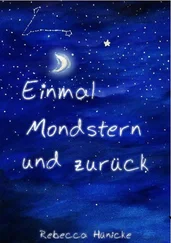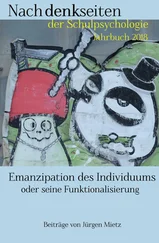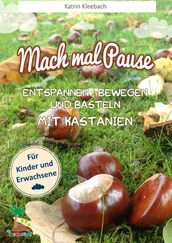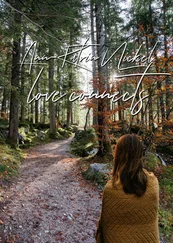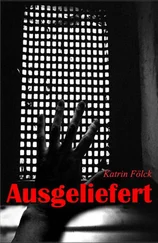Welche Folgen hatte die Industrialisierung für Gesellschaft und Familie?
Das kann man nur erahnen. Der britische Historiker John Hobsbawm (1917–2012) hat gesagt, die Industrialisierung sei die gründlichste Umwälzung menschlicher Existenz gewesen, die jemals in schriftlichen Quellen festgehalten worden sei. Und diese »gründlichste Umwälzung« hat alle Teile der europäischen Gesellschaft massiv verändert. In Deutschland (bis 1866 im »Deutschen Bund«, dann im Norddeutschen Bund und schließlich ab 1871 im Deutschen Reich) sank der Anteil der Landarbeiter von 73 Prozent auf 38 Prozent, während der Anteil der städtischen Arbeiter von 17 Prozent auf 55 Prozent stieg. Das hatte Konsequenzen für Familien, die allein deshalb auseinandergerissen wurden, weil immer mehr Männer der Arbeit hinterherziehen mussten (in die Städte), aber ihre Familien oft nicht mitkamen. Denn in den Städten gab es anfangs für die Heerscharen der Arbeiter nicht genügend Wohnraum, keine Schulen und keine Infrastruktur.
Gleichzeitig wuchs die deutsche Bevölkerung zwischen 1780 und 1914 von 21 auf 68 Millionen, obwohl Millionen Deutsche in mehreren Ausreisewellen ihre Heimat verließen und in die USA auswanderten. Heute haben mehr als 45 Millionen Amerikaner deutsche Wurzeln. Der Anteil der unter 14-jährigen Deutschen lag bei 33 Prozent, während die über 60-Jährigen nur 6 Prozent der Bevölkerung ausmachten. In dieser Zeit hat es auch Hungerkatastrophen gegeben, weil zwischen 1816 und 1847 drei Missernten verkraftet werden mussten. Außerdem überschwemmte englische Massenware, die man aus billigen Rohstoffen aus den Kolonien hergestellt hatte, Teile der kontinentaleuropäischen Märkte. Das löste Absatzeinbrüche und Aufstände etwa der Weber in Schlesien aus.
Inwiefern ist das wichtig für die Frage nach der Emanzipation?
Die neuen gesellschaftlichen Strukturen infolge der veränderten Produktionsbedingungen fanden auch in sozialen Bewegungen ihren Niederschlag: 1849 entstand der erste »gewerkschaftliche« Verband bei den Druckern, rund 10 Jahre später wurde der »Industrie- und Handelstag« gegründet. Fortan standen sich Arbeiternehmer und Arbeitgeber nicht mehr unmittelbar gegenüber, sondern wurden durch Verbände und deren Funktionäre vertreten. 1865 wurde der Allgemeine Deutsche Frauenverein gegründet, die Ziele klingen merkwürdig modern: Gleicher Lohn für Frauen und Bildungschancen verbessern. 1906 folgte die Gründung eines »Wandervogel-Ausschusses für Schülerfahrten in Berlin-Steglitz«. Die in dieser Bewegung versammelten Jugendlichen lehnten die Auswüchse der Industrialisierung mit ihrer Verstädterung und ihrem Materialismus ab, stattdessen propagierten sie den Rückzug in die Natur. Wenig später tauchten die ersten Reformpädagogen auf, die die überkommenen Erziehungsmethoden in Schule und Elternhaus ablehnten und die Jugendlichen frei von Zwang, ganzheitlich und gewaltfrei erziehen wollten. Bei ihnen lebte das Ideal der griechischen Antike wieder auf, nach dem der Mensch im Mittelpunkt der Pädagogik zu stehen habe und nicht die Erfüllung gesellschaftlicher Ansprüche.«
Matthias von Hellfeld lehrt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Von Hellfeld ist außerdem Mentor und Vertrauensdozent der Friedrich-Ebert-Stiftung sowie Geschichtsexperte in der Sendung »Eine Stunde History« bei Deutschlandfunk Nova.
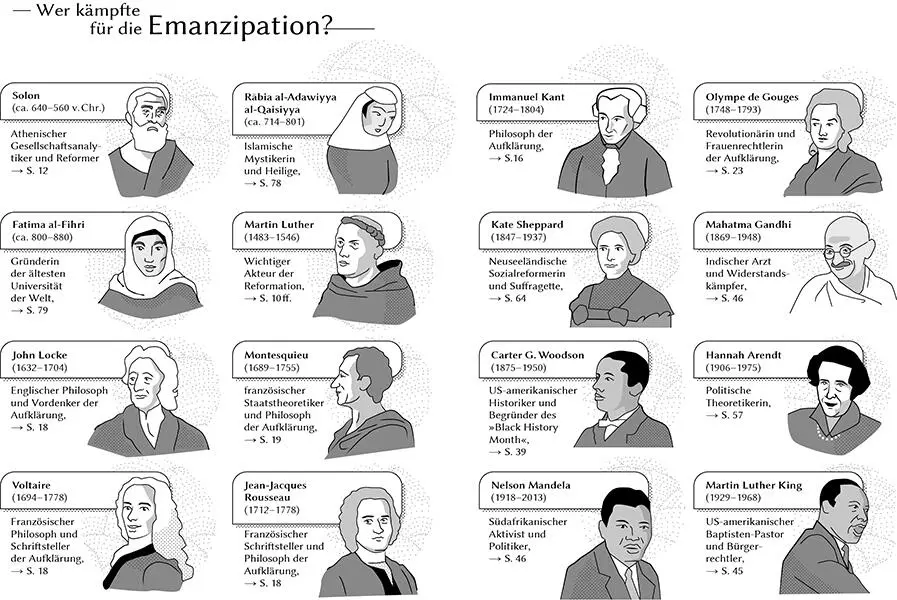
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.