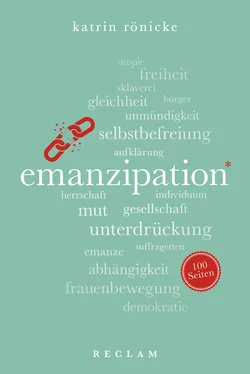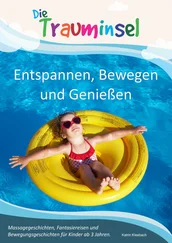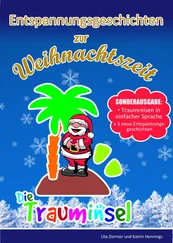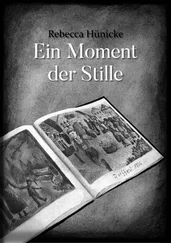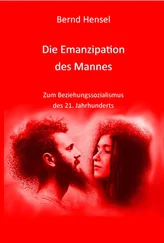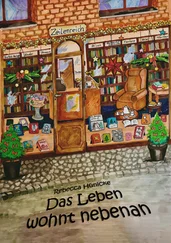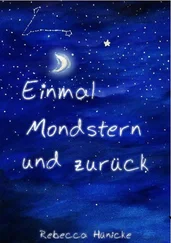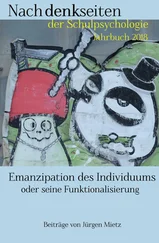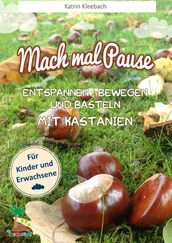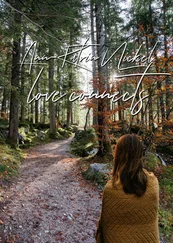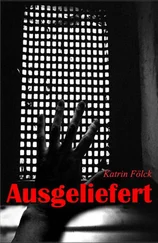Luther und die Reformation
1517 – ein halbes Jahrtausend vor unserer Zeit – schlug Martin Luther (1483–1546) seine berühmten 95 Thesen in Wittenberg an die Schlosskirche an. Darin richtete er sich gegen die Praxis der Kirche, von den Leuten, die ihrer Meinung nach Sünden begangen hatten, Geld zu verlangen und ihnen im Gegenzug die Sünden zu erlassen, auch bekannt als Ablasshandel. Der Ablasshandel war eine Idee zur Sanierung klammer Papst- und Fürstenkassen gewesen. Ihr tatsächliches, göttliches Fundament darf also stark angezweifelt werden – und genau das tat Luther dann auch. Seine 95 Thesen zum Ablasshandel wurden aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt und verbreiteten sich dank der neuen Erfindung des Buchdruckes ziemlich schnell über das ganze Land – und darüber hinaus. Aber das war nur der Anfang.
An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung hieß die erste von drei reformatorischen Hauptschriften, die Luther in den folgenden Jahren verfasste. Darin forderte er ein staatliches Bildungswesen, Armenfürsorge sowie die Abschaffung von Zölibat und Kirchenstaat. Zugleich ernannte er quasi alle Getauften zu Priestern – sein Ziel war, die alte Hierarchie zwischen Klerikern und ungebildetem Volk abzuschaffen. Diese Schrift wurde ein großer Erfolg mit großer Reichweite. Luther machte darin seinen Lesern klar: »Allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens, nicht die kirchliche Tradition.« – Ein echter Akt der Emanzipation!
Sicherlich wäre es eine sehr verengte Sicht auf die Geschichte, wenn man das Ende der Knechtschaft des Menschen im Mittelalter nur dem Jahr 1517 und seinen Folgen zuschreiben würde. Sowohl der Kapitalismus hatte bereits zuvor in Italien begonnen, seine Wirkung zu entfalten, als auch der Humanismus – eine ebenfalls von Italien ausgehende Bildungsbewegung, die sich auf antike Schriften berief. Aber die Reformation gab zusammen mit diesen Faktoren erst den nötigen Anstoß zum Ausbruch der Menschen aus ihrem starren gesellschaftlichen Korsett.
Die Emanzipation stellt das Individuum in den Mittelpunkt
Im Interview gibt der Historiker Matthias von Hellfeld einen Überblick über die verschiedenen Momente der Emanzipation in unserer Geschichte. Welche Denker und Lenker waren von zentraler Bedeutung?
Gibt es einen historischen Zeitpunkt, an dem die Emanzipation »erfunden« wurde?
Den zu benennen werden sich Historiker sicher schwer tun, aber immerhin reichen die Versuche, das Individuum in den Mittelpunkt politischen Handelns zu stellen, bis in die griechische Antike zurück. Der Reformer und oberste Beamte in Athen Solon (ca. 640–560 v. Chr.) löste im 6. Jahrhundert v. Chr. die »drakonischen Gesetze« seines Vorgängers Drakon ab und setzte eine Art Teilhabe der Menschen an den Entscheidungen des Gemeinwesens durch. Er ließ die Gesetze aufschreiben, so dass jeder die Regeln des Zusammenlebens prüfen und sich daran halten konnte. Der Willkür der Herrschenden war damit etwas entgegengesetzt. Bei Solon stand das emanzipierte Individuum im Mittelpunkt des Interesses. In den folgenden Jahren wurden die Rechte für den Einzelnen ausgebaut. Beim griechischen Philosophen Protagoras (490–411 v.Chr.) liest sich das so: »Der Mensch ist das Maß aller Dinge«.
Während der Zeit des Humanismus und der Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert wurde die griechische Antike wiederentdeckt. Nicht nur die Philosophen galten wieder etwas, sondern mit ihnen auch ihre Auffassungen vom Gemeinwesen und der Rolle des Menschen. Die Entdeckung des Individuums während des Renaissancehumanismus ging unmittelbar auf die griechische Antike zurück, weil sich die Dichter und Denker mit den Originaltexten beschäftigten und deren mittelalterliche Interpretationen außer Acht ließen. Insofern also begann die Emanzipation des Menschen bei den alten Griechen, deren Gedanken zuerst durch die »karolingische Renaissance« der Zeit Karls des Großen (ca. 747–814) vor dem Vergessen bewahrt und archiviert wurden. Über den Renaissancehumanismus kam der Gedanke der Emanzipation des Individuums zu uns in die Neuzeit.
War die Renaissance also ein emanzipatorisches Unterfangen?
Da fällt die Antwort eindeutig aus: Ja! Der Mensch wurde während der Renaissance auch mehr und mehr in den Mittelpunkt der Arbeit von Künstlern und Philosophen gerückt. Maler und Bildhauer fertigten zum ersten Mal Detailstudien des menschlichen Körpers an, sie malten die Menschen, wie sie wirklich aussahen – Hände, Gesichter, Füße oder ganze Akte.
Da die Künstler wissen wollten, wie der Mensch funktioniert und wie er unter der Haut aussieht, wurden illegale Obduktionen durchgeführt. Die Kirche wollte das mit aller Macht verhindern, weil sie befürchtete, dass dieses Wissen die Menschen von Gott und der Kirche emanzipieren würde. Diese nahezu biologische Entdeckung des Ich führte tatsächlich zu emanzipatorischen Ideen. Die Reformation Martin Luthers, die am Beginn der Moderne die alte römische Kirche erschütterte, ging von der Idee aus, es gebe eine direkte Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Gott nimmt also auch ohne Vermittlung der Kirche jeden Einzelnen wahr und schätzt ihn.
Diese Bedeutung oder Wichtigkeit des Individuums im Sinne Luthers gab es bis dahin in der Kunst nicht. Die Menschen waren auf Gemälden eher Beiwerk in der Sakralkunst. Gesichter wurden geradezu schematisch dargestellt. Es galt als wichtiger, Gott, seinen Sohn Jesus und den Heiligen Geist darzustellen, die alles auf Erden beherrschten und lenkten. Die Renaissancekünstler hingegen präsentierten den Menschen in seiner unvergleichlichen Schönheit. Leonardo da Vinci, Raffael, Michelangelo, Albrecht Dürer, Tizian und viele andere zeigten den Betrachtern zum ersten Mal ihr tatsächliches Ebenbild und entzogen es dadurch dem Mythos der »göttlichen Kreation«. Zwar blieb die religiöse Aufgabe der Kunst erhalten – schließlich war die Kirche meistens die Auftraggeberin –, aber die neuen Bilder signalisierten die gestiegene Bedeutung des Menschen in der Kunst. Die Künstler schufen ein Abbild der Menschen und nahmen ihnen so den Schleier einer Gotteskreation.

Diese berühmte Zeichnung von Leonardo da Vinci entstand 1490 und zeigt den männlichen Körperbau so detailliert wie realistisch.
Welche geschichtlichen Voraussetzungen führten dazu, dass es zur Aufklärung kam?
Viele Länder Europas waren in der Mitte des 17. Jahrhunderts nach dem Schrecken des Dreißigjährigen Krieges in wirtschaftliche und soziale Schwierigkeiten geraten, Städte und Dörfer waren teilweise niedergebrannt, Familien dezimiert. Lange Zeit hatten marodierende Banden sich genommen, was sie wollten, und vielen Menschen die Lebensgrundlage entzogen. Mehr als vier Millionen Tote verringerten die europäische Bevölkerung auf etwa 70–75 Millionen. Während sich in England mit der »Glorious Revolution« 1689 Parlamentarismus und konstitutionelle Monarchie durchsetzten, begann in Frankreich die Epoche des Absolutismus. Französische Herrscher waren absolutistische Könige aus eigener Machtvollkommenheit, deren Untertanen sich politisch in keiner Weise einbringen konnten. In diesem Klima der Unfreiheit begannen vor allem in Frankreich, aber auch in anderen Ländern Europas, Philosophen darüber nachzudenken, wie diese den Fortschritt behindernden Strukturen überwunden werden könnten, um eine Atmosphäre des rationalen Denkens und Handelns zu schaffen. Sie wollten die Welt mit der Vernunft begreifen und Entscheidungen nach rationalen Kriterien fällen. Man könnte sagen, die Maxime der Aufklärer lautete: »Wissen statt Glauben«.
Читать дальше