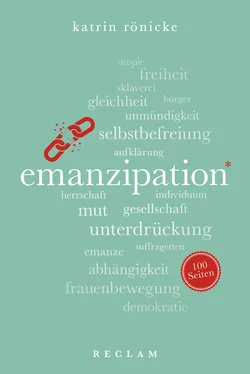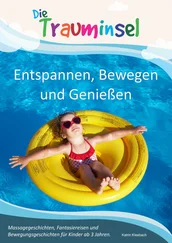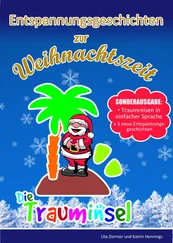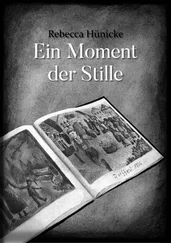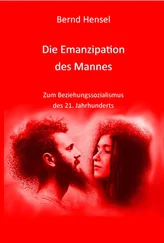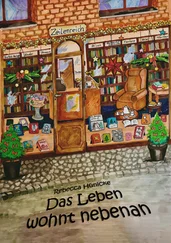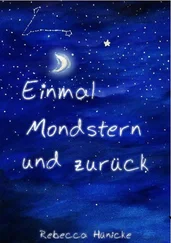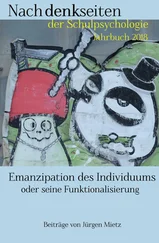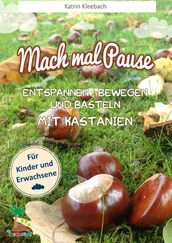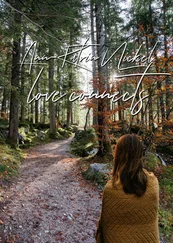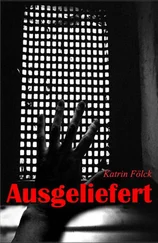Katrin Rönicke - Emanzipation. 100 Seiten
Здесь есть возможность читать онлайн «Katrin Rönicke - Emanzipation. 100 Seiten» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Emanzipation. 100 Seiten
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Emanzipation. 100 Seiten: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Emanzipation. 100 Seiten»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Emanzipation. 100 Seiten — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Emanzipation. 100 Seiten», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Zum ersten Mal fanden ihre Gedanken in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 Widerhall. In Frankreich trafen aufklärerische Ideen auf eine Situation großer gesellschaftlicher Ungerechtigkeit: Bauern und Handwerker hatten sämtliche Ausgaben des Staates zu tragen, Adel und Klerus hingegen waren von Steuern befreit. Dass diese unerträgliche soziale Lage ein Ende haben musste, war leicht zu vermitteln. 1789 mündete das in die Französische Revolution. Die Revolutionäre ließen innerhalb kurzer Zeit ihren Worten auch Taten folgen, indem sie ihre Vorstellungen teilweise mit brutaler Gewalt durchsetzten: Sie entmachteten den Adel sowie den Klerus, führten eine Säkularisierung durch, schafften Steuerprivilegien ab und beendeten – jedenfalls für einen gewissen Zeitraum – die Monarchie.
Was genau bedeutete »Aufklärung«?
Man könnte es sich einfach machen und den Satz von Immanuel Kant (1724–1804) zitieren, wonach die Aufklärung der »Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« sei. Tatsächlich ist dies der prägende Satz der Aufklärung, und er beschreibt auch, was die Aufklärer eigentlich erreichen wollten. Solange dem Menschen durch das Definitionsmonopol der Kirche ein Verhaltenskodex vorgesetzt war, dessen Missachtung Sanktionen nach sich zog, war er eben »unmündig«. Um das Gegenteil zu erreichen, mussten die Menschen umfassend gebildet werden. Würde der »Glaube« (an die Kirche, den Papst und Gott) durch »Wissen« (über alle Zusammenhänge des Lebens) ersetzt, wäre der Mensch in der Lage, eine eigene Entscheidung zu fällen– und damit seine »selbst verschuldete Unmündigkeit« zu verlassen. »Habe den Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen«, formulierte Kant in seiner 1784 erschienenen Schrift »Was ist Aufklärung?«. Die Verwendung des Verstandes war auf gesicherte Erkenntnisse oder wissenschaftlichen Studien angewiesen, deshalb setzte die Aufklärung auch eine Verwissenschaftlichung der Welt in Gang. Überall sollte der Glaube durch Wissen ersetzt werden, Wissen musste gesammelt und den Menschen zugänglich gemacht werden.
Sichtbarster Ausdruck war die in der Mitte des 18. Jahrhunderts entstandene Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers . Die beiden Aufklärer Denis Diderot und Jean Baptiste le Rond d’Alembert sowie 142 weitere Autoren trugen in 35 Bänden dieser »Enzyklopädie des Wissens«, die zwischen 1751 und 1780 erschien, das Wissen der damaligen Welt zusammen. Jeder konnte in diesem vielbändigen Werk nachlesen und erfahren, was die Welt zu dieser Zeit wusste, wie Waren hergestellt wurden oder nach welchen Prinzipien in den Manufakturen gearbeitet wurde.
150 Jahre später entwickelte der Soziologe Max Weber (1864–1920) den Begriff der »Entzauberung der Welt«: Die gestiegene »Intellektualisierung und Rationalisierung«, schrieb er, habe nicht nur die allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen verbessert, sondern auch die Überzeugung verbreitet, dass es »prinzipiell keine geheimnisvollen unberechenbaren Mächte« gebe, sondern dass man alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnen beherrschen könne. Das aber, so Weber weiter, »bedeutet die Entzauberung der Welt«. In dieser vollständig rationalen Welt war für die Kirche und den Glauben an einen Gott, die das genaue Gegenteil der Aufklärung darstellten, kein Platz mehr. Dementsprechend waren die Aufklärung und die Französische Revolution, in der einige Gedanken der Aufklärung politisch umgesetzt wurden, ein Frontalangriff auf Papst und Kirche.
Welche historischen Figuren waren besonders wichtig für die Aufklärung?
Ein paar Namen ragen heraus aus der Vielzahl der Philosophen, die die Aufklärung beeinflusst haben. Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) aus Genf entwarf den »Gesellschaftsvertrag«, der als Ausdruck eines »idealen Gemeinschaftswillens« ein gesellschaftliches Organisationsmodell darstellte, dem sich der aufgeklärte Mensch aus eigenem und freiem Willen unterwerfen könne. Indem der Mensch sich freiwillig unterwerfe, sei er nicht mehr an den Willen der Obrigkeit gebunden, sondern handele aus eigener Überzeugung – so die optimistische Grundidee Rousseaus. In seinem pädagogischen Hauptwerk Emile oder über die Erziehung schilderte er die ideale Erziehung. Rousseau stellte sich darin einen Menschen vor, der als Erwachsener in der Lage sein wird, den Gesellschaftsvertrag zu schließen, weil er gelernt hat, dass er eigentlich sich selbst gehorcht, wenn er dem Gesellschaftsvertrag gehorcht.
Der Franzose Voltaire (1694–1778) gehört ebenfalls zu den wichtigsten Aufklärern – mitunter wird das 18. Jahrhundert als »das Jahrhundert Voltaires« bezeichnet. Er kritisierte den Absolutismus und die Feudalherrschaft in Frankreich, galt aber auch als schärfster Kritiker der katholischen Kirche. Die Ideen des Deutschen Immanuel Kant haben sowohl die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung als auch die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 ebenso beeinflusst wie sämtliche demokratische Verfassungen der Neuzeit und die Deklaration der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen von 1948. Auch der Brite John Locke (1632–1704) ist von Bedeutung. Er lieferte die Grundlage einer demokratischen Verfassung, indem er sagte, dass eine Regierung nur dann legitim sei, wenn sie die Zustimmung der Regierten habe. Zudem müsse eine so legitimierte Regierung das Naturrecht auf Leben, Freiheit und Eigentum schützen.
Auf den Franzosen Montesquieu (1689–1755) geht das Prinzip der Gewaltenteilung zurück. Er studierte Aufstieg und Niedergang des Römischen Reichs und stellte anschließend fest, dass die Freiheit des Individuums garantiert werden müsse. Zudem könne eine Gesellschaft nur dann bestehen, wenn Legislative, Exekutive und Judikative strikt voneinander getrennt seien. Dieses Prinzip der Gewaltenteilung gilt bis heute in allen demokratisch verfassten Staaten.
Gehen wir in der Geschichte ein wenig weiter: Was passierte im 19. Jahrhundert – und wieso wird es eigentlich »lang« genannt?
Auch das ist unter Historikern durchaus umstritten. Manche bleiben beim kalendarischen Beginn und Ende des Jahrhunderts, andere verweisen darauf, dass wirkmächtige Ideen des 18. Jahrhunderts das 19. Jahrhundert maßgeblich beeinflusst, ja geradezu vorherbestimmt hätten. Die beiden Revolutionen in Amerika und Frankreich von 1776 bzw. 1789 haben politische Ideen in die Welt gesetzt, die auch das folgende Jahrhundert geprägt haben: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit waren Fanfarenstöße, die über ganz Europa zu hören waren und zu vielen Revolutionen und Umsturzversuchen im 19. Jahrhundert führten.
Zudem war das 19. Jahrhundert von mindestens zwei Entwicklungen geprägt, die wiederum das 20. Jahrhundert maßgeblich beeinflussten: der Industrialisierung und den Nationalstaatsbewegungen. Die Industrialisierung, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts immer stärker verbreitete, machte viele der zeitgleich entstehenden Nationalstaaten zu Konkurrenten um Rohstoffe, Absatzmärkte oder Kolonien. Einige Historiker sehen im infolgedessen übersteigerten Nationalismus eine der wesentlichen Ursachen für den Ersten Weltkrieg (1914–1918), der die »Urkatastrophe« des 20. Jahrhunderts war. Als Ergebnis dieses Weltkrieges wurde im Vertrag von Versailles 1919 u. a. festgehalten, dass Deutschland und Österreich/Ungarn die alleinigen Verursacher des Krieges gewesen seien. Die Nationalsozialisten riefen nach einer Revision dieses als »Schandfrieden« bezeichneten Vertrags und wollten diese im Zweiten Weltkrieg vollziehen.
Das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs war aber nicht die Revision des Vertrags von Versailles, sondern die Spaltung des europäischen Kontinents und die Teilung Deutschlands. Der nach 1945 im »Kalten Krieg« manifestierte Gegensatz zwischen Sozialismus und Kapitalismus bestimmte den größten Teil der weltweiten Nachkriegspolitik. Die politischen Revolutionen in vielen Ostblockstaaten leiteten 1989/90 das Ende des »Kalten Krieges« ein. Die Auflösung des ideologischen Antagonismus zwischen Ost und West revidierte einen Großteil der Ergebnisse der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts: Viele Staaten des Balkan wurden wieder gegründet, die deutsche und europäische Teilung wurde aufgehoben und die politischen wie ökonomischen Beziehungen zwischen Ost und West normalisierten sich. Insofern kann man sagen, dass das 19. Jahrhundert lang war und von 1776 bis 1914 reichte. Folgerichtig war das 20. Jahrhundert »kurz« und reichte unter diesem Blickwinkel nur von 1914 bis 1990. Derzeit deutet sich allerdings an, dass die politischen Entwicklungen seit den Anfangsjahren des 21. Jahrhunderts wieder zu einer Situation führen könnten, die der des »Kalten Krieges« ähnlich ist.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Emanzipation. 100 Seiten»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Emanzipation. 100 Seiten» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Emanzipation. 100 Seiten» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.