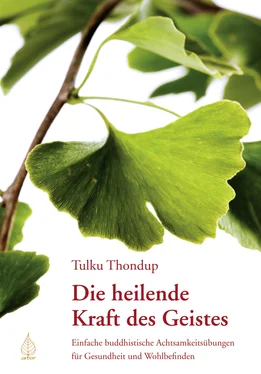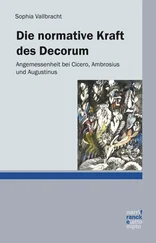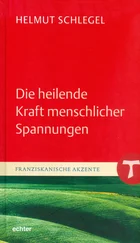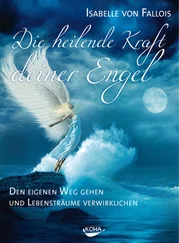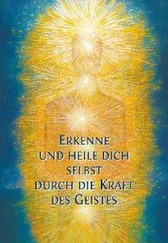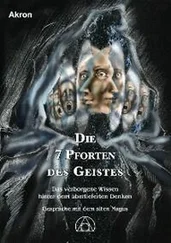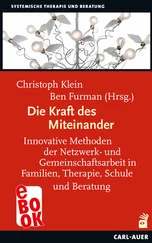Plötzlich durchschoß meinen rechten Fuß ein Schmerz, und mein ganzer Körper zog sich vor unerträglicher Pein zusammen. Jetzt war alles, was ich fühlte und sah, in diese einzige Erfahrung umgewandelt – den Schmerz. Zuerst hatte ich keine Ahnung, was geschehen war. Dann hörte ich ein summendes Geräusch, das von meinem Fuß kam. Eine Hummel hatte sich zwischen meinen Zehen verfangen, aber ich konnte die Zehen nicht spreizen, um sie freizulassen. Je heftiger sie mich stach, desto heftiger krampften sich meine Zehen zusammen. Während meine Zehen sich zunehmend anspannten, stach meine Peinigerin immer wieder zu, und mein Schmerz wurde größer. Schließlich eilte einer meiner Freunde herbei und drückte meine Zehen auseinander, um die Hummel freizulassen. Erst dann hörte der Schmerz auf.
Wenn wir dies nur klar erkennen könnten, wie mentales Ergreifen unsere Schwierigkeiten hervorruft! Wenn wir unser Festhalten an einem Selbst verstärken, wächst unser physischer, mentaler und spiritueller Schmerz. In unserer Verwirrung greifen wir immer fester und fester zu und setzen so den Leidenskreislauf in Bewegung, der die Welt von Samsara kennzeichnet. Selbst wenn wir uns voller Freude vergnügen, kann sich jeden Moment Schmerz einstellen, und darum klammern wir uns oft fest an das, was wir haben, aus Angst vor der Möglichkeit des Verlusts.
Der buddhistischen Mahayana-Philosophie zufolge durchirren wir ziellos diese Welt, blind gegenüber der inneren Kraft, die uns befreien kann. Unser Geist fabriziert Begierden und Abneigungen, und wie ein Betrunkener tanzen wir wild zu der von Unwissenheit, begehrlichem Anhaften und Haß vertonten Melodie. Das Glück ist flüchtig; die Unzufriedenheit verfolgt uns. Es ist alles wie ein Alptraum. Solange wir davon überzeugt sind, daß der Traum real ist, sind wir seine Sklaven.
Um zu erwachen, müssen wir die trübenden Schleier vor der wahren Natur unseres Geistes entfernen. Vor vielen Jahrhunderten gab ein indischer Prinz namens Siddharta Gautama seinen Anspruch auf den Fürstenthron auf und realisierte nach langer und tiefer Meditation die Wahrheit über die wirkliche Beschaffenheit des Lebens. Eben dadurch wurde er als der Buddha bekannt. Im Sanskrit bedeutet das Wort buddha »erwacht«. Auch wir können erwachen. Der Heilungsprozeß ist ein Erwachen zur Kraft unseres eigenen Geistes.
Der Geist ist der Hauptfaktor
Wie ein Arzt müssen wir die Krankheit diagnostizieren, die Ursache des Problems ausräumen und die Medizin anwenden, die zu guter Gesundheit führt. Asanga, der Begründer der Nur-Geist-Schule des Buddhismus, schreibt:
Da es erforderlich ist, die Krankheit zu diagnostizieren, ihre Ursache auszuräumen,
das Glück guter Gesundheit zu erlangen und eine Medizin dafür anzuwenden,
Sollte man das Leiden klar erkennen, die Ursache ausräumen,
das Mittel, das ihm ein Ende bereiten soll, anwenden und erreichen, daß es aufhört.
Im Buddhismus sind die Diagnose und das Mittel in den Vier Edlen Wahrheiten enthalten: der Wahrheit, daß wir leiden, der Wahrheit darüber, weshalb wir leiden, der Wahrheit, daß wir unser Leid beenden können, und der Wahrheit über den Weg, der zur Freiheit führt. Wir können uns dazu entscheiden, diesem Weg zu folgen. Sogar während wir mit alltäglichen Schwierigkeiten kämpfen, können wir unser Leben verbessern. Der Geist ist der Schlüssel dazu. Indem wir unseren Geist angemessen lenken und schulen, können wir die Kraft der Heilung erfahren. Im Dharmapada heißt es:
Der Geist führt die Phänomene an.
Der Geist ist der Hauptfaktor und Vorläufer aller
Handlungen.
Spricht oder handelt man mit gefühllosem Geist,
folgt Elend nach, wie der Karren dem Zugpferd folgt.
Die Phänomene werden vom Geist angeführt.
Der Geist ist der Hauptfaktor und Vorläufer aller Handlungen.
Spricht oder handelt man mit reinem Geist,
folgt Glück nach, wie der Schatten seinem Ursprung folgt.
Wirkliches und lange währendes Glück rührt nicht von materiellen oder äußeren Umständen her, sondern erwächst aus Zufriedenheit und Geistesstärke. Dodrupchen schreibt:
Erfahrene Menschen erkennen klar, daß Glück und Leid vom Geist abhängen, und sind daher bestrebt, vom Geist selbst Glück zu erlangen. Weil sie einsehen, daß die Glücksursachen zur Gänze in uns liegen, verlassen sie sich nicht auf äußere Quellen. Haben wir diese klare Erkenntnis, dann werden uns Probleme, mit denen wir konfrontiert sind – seien sie nun von Wesen oder von physischer Materie verursacht –, nichts anhaben können. Außerdem sollte uns ebendiese Geistesstärke auch durchdringen, um Frieden und Glück zum Zeitpunkt unseres Todes zu gewährleisten.
Das wahre Wesen unseres Geistes ist friedvoll. Indem wir lernen, wie man unnötige Sorgen und Belastungen losläßt, geben wir der Freude die Chance aufzuleuchten. Es hängt alles von unserem Geist ab. Buddhisten glauben, daß es möglich ist, Emotionen umzuwandeln; daß Freude nicht nur möglich ist, sondern wir ein Anrecht darauf haben. Wir müssen keineswegs von Kummer beherrscht sein. Loszulassen ist eine dem gesunden Menschenverstand entsprechende Verhaltensweise, es ist nicht irgendeine seltsame Einstellung, die auf eine bestimmte Religion oder Philosophie beschränkt wäre. Wie es in der Neuen Jerusalemer Bibel (Jesus Sirach 30, 22ff.) *heißt:
Überlaß dich nicht der Sorge,
schade dir nicht selbst durch dein Grübeln!
Herzensfreude ist Leben für den Menschen,
Frohsinn verlängert ihm die Tage.
Überrede dich selbst, und beschwichtige dein Herz,
halte Verdruß von dir fern!
Denn viele tötet die Sorge,
und Verdruß hat keinen Wert.
Neid und Ärger verkürzen das Leben,
Kummer macht vorzeitig alt.
Der Schlaf des Fröhlichen wirkt wie eine Mahlzeit,
das Essen schlägt gut bei ihm an.
Wie man in der Welt leben soll
Manche betrachten den Buddhismus als eine Religion für Menschen, die ein Stadium der Glückseligkeit erreichen wollen und dann in eine Art Nichtexistenz entschwinden, weit weg von anderen Menschen. Das ist keineswegs eine zutreffende Vorstellung vom Buddhismus. Buddhisten halten viel von der vollen Teilnahme am Leben. Der Weg der Heilung schließt Probleme und Schwierigkeiten nicht aus; genaugenommen begreift er sie als ein Mittel zur Realisierung unseres wahren Wesens ein.
Wir können an Probleme, die dem Anschein nach völlig negativ sind, konkret und praktisch denkend herangehen. Sind wir in einer Streßsituation, dann sollten wir sie anerkennen und uns mit ihr aussöhnen, indem wir uns sagen: »Sie ist schlimm, aber sie ist schon in Ordnung.« Wenn wir uns angesichts der Situation nicht durch das Verketten unserer negativen Vorstellungen von ihr verrückt machen, dann wird sich ihr Einfluß erschöpfen; denn diese Situation ist, wie alles im Leben, vergänglich und wird sich früher oder später ändern. In diesem Bewußtsein können wir ruhig den nächsten Schritt zur Heilung unternehmen, mit dem sicheren Gefühl, daß äußere Situationen unsere innere Weisheit nicht zu überwältigen vermögen.
Nach buddhistischer Ansicht sind Emotionen letztendlich weder gut noch schlecht. Wir sollten all unsere Gefühle akzeptieren und billigen. Gleichzeitig brauchen wir uns nicht von heftigen oder destruktiven Emotionen beherrschen zu lassen. Sind wir anfällig für Sehnsüchte, Anhaftungen, Verwirrung oder Haß, dann empfiehlt es sich, eher darüber nachzudenken, »was zu tun für mich richtig ist«, statt darüber, »was ich tun möchte«. Während wir den Weg der Heilung betreten, sollten wir unsere Vorsätze stärken. Unsere Emotionen sollten wir von unserem Geist lenken lassen.
Wenn etwas außerhalb von uns Befindliches die Quelle sein soll, die uns letztendlich zufriedenstellt, dann werden wir das Gefühl haben, zwischen Befriedigung und Frustration Achterbahn zu fahren. Festhalten liefert uns auf Gedeih und Verderb dem sich ständig drehenden Rad von Samsara aus, der flüchtigen Welt aus Schmerz und Lust. Wenn wir das Selbst loslassen und unseren wahren friedvollen Mittelpunkt finden, erkennen wir, daß es nicht nötig ist, uns an die Begriffe von gut und schlecht, glücklich und traurig, dieses und jenes oder »ich« und »die anderen« zu klammern. Viele Religionen und Philosophien warnen davor, sich zu stark mit dem Ich zu identifizieren. Die als »Upanischaden« berühmt gewordenen hinduistischen Schriften vergleichen diese Identifikation mit einer Falle: »Indem man denkt ›Das bin ich‹ und ›Das ist mein‹, verfängt man sich im eigenen Ich wie ein Vogel in einer Schlinge.«
Читать дальше