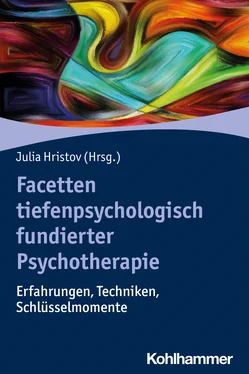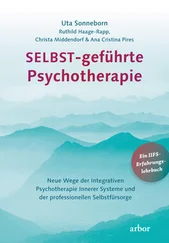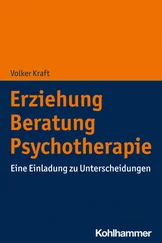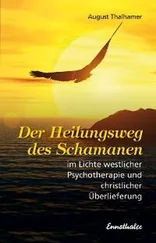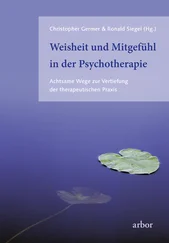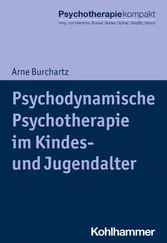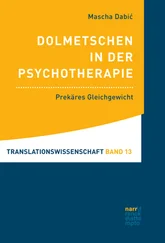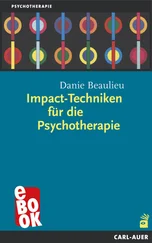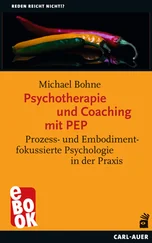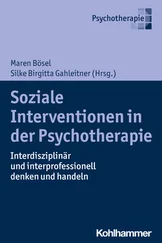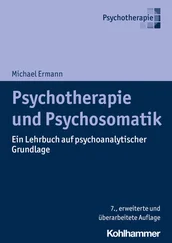Keinesfalls darf hier vergessen werden, wie viel Mut zur Veränderung die Patienten*innen haben!
Ähnlich wie psychische Störungen für Therapeut*innen in der therapeutischen Beziehung erlebbar werden, kann die psychische Störung für Patient*innen durch ein Bild erlebbarer werden. Viele Therapeut*innen stimmen darin überein, dass die Bildersprache eine gute Möglichkeit ist, weg vom einschränkenden Alltagsdenken hin zum kreativen Erleben zu kommen. Für C. G. Jung (1875–1961) konnten Bilder eine Quelle tiefer Einsichten und heilsamer Kräfte sein. Die Bildersprache in Form von Metaphern oder Geschichten kann bereits in den ersten Begegnungen förderlich sein, psychische Probleme oder auch Beziehungsdynamiken ins Erleben zu bringen.
Ein junger, musikalischer Patient mit sozialer Phobie erlebte nach dem Prinzip »Aus den Augen, aus dem Sinn« eine Abschwächung von Bindungen,wenn er den aktuellen Kontakt zu einem Menschen vorübergehend unterbrach. Ich gab ihm das musikalische Bild eines »Fade out«, wie es das Ende eines Liedes markiert. Endeten Begegnungen, war es für ihn nun so, als verstummte allmählich ein Lied. Durch dieses Bild konnte er sein Problem erleben und beginnen zu verstehen.
Eine Patientin mit umfassenden strukturellen Defiziten hatte Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des eigenen inneren Raumes und demzufolge in der grundlegenden Fähigkeit, sich selbst wahrzunehmen. Zur bildlichen Darstellung verwendete ich gern die Metapher der Murmelbox, aus welcher die Murmeln (ihre Gefühle und ihr Erleben) immer wieder herausrollen und in welche die Murmeln immer wieder einzeln eingesammelt, betrachtet und sortiert werden können.
Nach den ersten Begegnungen erstelle ich praktischerweise für jede*n einzelne*n Patient*in eine Übersicht oder ein Fokusblatt mit allem Wichtigen, um es auf einen Blick wiederzufinden. Dazu gehören eine Liste zum Abhaken für alle Formalien und wesentliche psychodynamische Puzzleteile wie der Auslöser, eine eindrückliche Szene, die Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamik, Bedeutsames der Biografie, alle diagnostischen Informationen und der mit dem*der Patient*in zur Bearbeitung abgestimmte zentrale Konflikt bzw. Fokus. Alles weitere Auffällige beschreibe ich wahlweise, wie die Medikation, den Zuweisungskontext, den impliziten Auftrag, die Neigung zu Suchtverhalten oder Selbstverletzungen.
Mithilfe des Fokusblattes ordne ich die Fülle an Eindrücken in den ersten Begegnungen und kann mich so besser auf den auslösenden Konflikt und den Behandlungsfokus konzentrieren. Schon die ersten Begegnungen ermöglichen tiefe Einsichten, sodass das Fokusblatt meistens über die gesamte Therapie hinweg erstaunlich aktuell bleibt. Da der eigentliche zentrale Konflikt den Patient*innen nicht bewusst ist und erst mithilfe der Psychotherapie bewusster werden kann, ist es ein gutes Zeichen, wenn sich der Behandlungsfokus im Laufe der Psychotherapie verändert.
Natürlich kann dieses Übersichtsblatt auch wie ein Tropfen Blut unter dem Mikroskop betrachtet werden: Schreibe ich zum Beispiel konfus oder entstehen viele weiße Flächen? Dann scheinen mir und höchstwahrscheinlich auch dem*der Patient*in viele Regionen seiner*ihrer inneren psychischen Landschaft noch unklar oder unentdeckt zu sein.
Auf der Grundlage des in den ersten therapeutischen Begegnungen Erlebten und Verstandenen wird der*die Patient*in einschließlich seines*ihres komplexen psychischen Krankheitszustandes als Ganzes sichtbar und der*die Behandler*in kann ein stimmiges Gesamtbild zeichnen.
Die ersten Begegnungen sind wie der Beginn einer Reise. Es ist aber kein Reisebeginn mit der Fahrt auf einer Autobahn oder in ein All-inklusive-Hotel; es handelt sich vielmehr um Rucksacktouristik. Was muss eingepackt werden? Welche Ziele können erreicht werden und welche nicht? Auf welchen Wegabschnitten gibt es Gefahren? Mit diesen Bildern im Gepäck kann die Reise starten oder besser gesagt weiter gehen.
Wie in diesem Artikel ausgeführt, hat die Reise bei der Kontaktanbahnung längst begonnen. Schon die ersten Begegnungen – und in manchen Fällen sogar das Vorfeld – können in vielerlei Hinsicht Hinweise auf den gesamten Therapieverlauf geben.
Argelander, H. (2014). Das Erstinterview in der Psychotherapie (10. Aufl.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Boessmann, U. & Remmers, A. (2017). Das Erstinterview. Praxis der psychodynamischen Anamneseerhebung, Diagnostik, Indikationsstellung und Therapieplanung (Nachdruck der 1. Aufl.). Berlin: Deutscher Psychologen Verlag.
Boessmann, U. & Remmers, A. (2018). Praktischer Leitfaden der tiefenpsychologisch fundierten Richtlinientherapie. Wissenschaftliche Grundlagen, Psychodynamische Grundbegriffe, Diagnostik (2. Aufl.). Berlin: Deutscher Psychologen Verlag.
Buchholz, M. B. (2007). Zur Diskussion. Entwicklungsdynamik psychotherapeutischer Kompetenz. Psychotherapeutenjournal, 4/2007, 373-382.
Körner, J. (2018). Psychodynamische Interventionsmethoden. Psychodynamik Kompakt. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Mentzos, S. (2015). Lehrbuch der Psychodynamik. Die Funktion der Dysfunktionalität psychischer Störungen (7. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Rudolf, G. (2019). Psychodynamisch denken – tiefenpsychologisch handeln. Praxis der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie (3. Nachdruck der 1. Auflage). Stuttgart: Schattauer.
Wöller, W. & Kruse, J. (2018). Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. (5. Aufl.). Stuttgart: Schattauer.
Zwiebel, R. (2013). Was macht einen guten Psychoanalytiker aus? Grundelemente professioneller Psychotherapie. Stuttgart: Klett-Cotta.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.