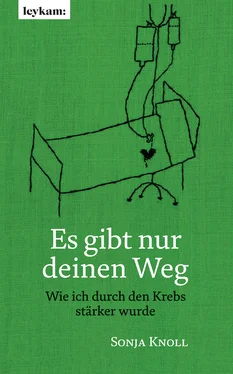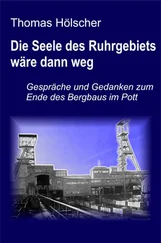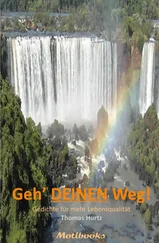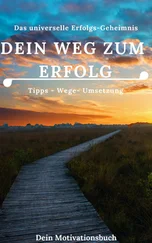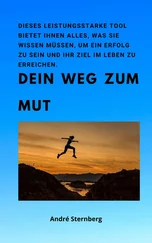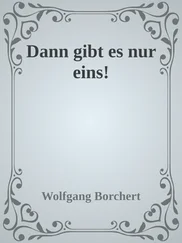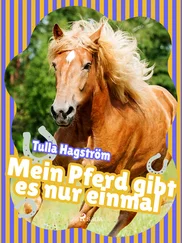Wann hat diese Sudoku-Sucht begonnen? Seit wann fühle ich mich getrieben, die 9 x 9 Kästchen mit Zahlen zu füllen? Seit wann gehe ich ohne Sudoku-Büchlein in der Handtasche nicht mehr aus dem Haus? Sudoku besteht aus 81 Kästchen in 9 x 9 Reihen angeordnet, in die nach bestimmten Regeln Zahlen einzufügen sind, die man durch Kombinieren und Logik ermitteln kann. Es gibt kein Raten, kein Fühlen oder Erahnen, sondern Regeln, Vorschriften, an die man sich halten muss, will man erfolgreich sein. Wenn man diese Regeln kennt und befolgt, kann man ein Sudoku korrekt lösen und des Erfolgs gewiss sein. Das Rätsel ist klar strukturiert, Analyse und logisches Denken führen zum Ziel.
Mein Leben ist gerade das Gegenteil. Ich fühle mich in einem Spiel gefangen, dessen Regeln ich nicht kenne, die ich daher nicht befolgen kann. Ich weiß nicht, wie ich handeln soll, um zum Ziel zu gelangen. Und mit Analyse und Logik geht schon gar nichts. Ich komme mir vor wie in einem Labyrinth, sehe immer nur ein kleines Stück Weg vor mir, links und rechts Mauern, ständig Abzweigungen, und ich weiß nicht, welche ich nehmen soll, weil ich weder deren Möglichkeiten noch die Alternativen kenne. Mein Leben besteht aus Fragezeichen, Ausrufezeichen und Bindestrichen ohne Text dazwischen. Ich finde keine Antworten, weil ich nicht einmal die Fragen kenne. Es gibt nur unsichere Informationen und Wahrscheinlichkeiten.
Niemand kann mir klare Handlungsanweisungen fürs Überleben geben.
Die Ärzte nicht.
Die Psychologen nicht.
Die Ernährungsberater nicht.
Die Eltern nicht.
Und Gott redet sowieso nicht mit mir.
Sudoku bedeutet Überschaubarkeit. Das methodische Ausfüllen der Kästchen vermittelt Sicherheit und das Gefühl, durch Nachdenken etwas zu erreichen. Hier kann ich mich darauf verlassen, dass es eine Lösung gibt, wenn ich das Richtige tue. Und es gibt eine richtige Art der Lösung, die ich verstehe und beherrsche. Es gibt einen Weg zum Ziel.
Hier habe ich die Kontrolle. Hier wird alles gut.
Die Medikamente greifen die Nerven an.
In manchen Nächten kann ich das Grauen sehen.
Es beginnt unter der Matratze, lauert unter dem Schlafzimmerboden.
Ich schwebe knapp über einem schwarzen Teich unter meinem Bett – es ist das Nachtmeer, das Totenmeer, das Grauenmeer. Ich starre hinein. Ich sehe mein bleiches Gesicht verzerrt, zersplittert vom schäumenden Wasser.
Ich weiß: Unter der Oberfläche lauern spitzzahnige Raubfische aus den tiefsten Tiefen, mit dünnen, sich schlängelnden Barteln und gezackten Rückenschuppen. Ihre riesigen milchigen Augen glotzen mich ausdruckslos an. Sie warten nur darauf, dass ich ins Wasser stürze – das kann jeden Augenblick geschehen. Sie werden mich zerreißen. Ihre glitschigen Leiber werden sanft und kalt an meinen Beinen, meinem Bauch, meinen Armen entlangstreichen, wenn ich ins Bodenlose sinke.
Mir ist schlecht. Ich möchte erbrechen.
Ich möchte aus dem Albtraum erwachen.
Ich bin wach. Im Nebenzimmer schläft mein Kind.
Ich schreie mein Entsetzen in meinen Kopfpolster.
»Guten Morgen, Herr Doktor Jeschko!«
Der Onkologe muss immer lächeln, wenn ich ihn begrüße. In der Schweiz gelten Titel und akademische Grade nicht viel, nicht einmal Ärzte werden als Herr oder Frau »Doktor« angesprochen. Eine Schweizerin würde mit »En guete Tag, Härr Jeschko« grüßen.
Seit ein paar Wochen habe ich nun diesen neuen Onkologen. Ich fühle mich gut aufgehoben und ernst genommen.
»Guten Morgen, Frau Knoll. Wie geht es Ihnen heute?«
»Todmüde. Ich komm kaum aus dem Bett in der Früh!«
»Dann bleiben Sie doch liegen! Sie wissen, Sie sollen sich schonen. Die Chemo ist keine Vitaminkur ...«
»Ich tu ja eh schon nix mehr, lieg nur mehr in der Wohnung herum!« Ich werde ein bisserl ungeduldig – von allen Seiten höre ich, dass ich nichts tun soll, dem Körper Zeit lassen und Gelegenheit geben, sich von der Chemo-Tortour zu erholen.
Und wer, bitte, erledigt dann, was erledigt werden muss? Ich lebe allein mit einer 13-Jährigen, kann mir keine Putzfrau leisten, keinen Koch, keine Einkäuferin. Und meine Freundinnen, die mir ihre Hilfe anbieten, mag ich nicht zu oft strapazieren, die haben ihre eigenen Familien.
»Sie haben eine Tochter, nicht wahr?«
Ja, eben! schreit es ärgerlich in mir –
»Ja, Dominique, sie ist jetzt 13 Jahre alt«, antworte ich ruhig.
»Wie geht es Ihnen mit ihr? 13 kann ein schwieriges Alter sein.«
»Wem sagen Sie das! Nach dem ersten Schock der Diagnose hat sie sich ziemlich zurückgezogen, sie will mit mir nicht über die Krankheit sprechen. Wenn ich mit Freundinnen darüber am Telefon rede, geht sie aus dem Zimmer. Ich bemühe mich, dass unser Alltag so normal wie möglich weiterläuft.«
Ich merke an meiner Wortwahl, dass ich den Begriff »Krebs« vermeide. Es ist immer »die Krankheit«.
»Wie soll ich mir das vorstellen, Frau Knoll. Sie leben wie zuvor!?«
»Ich möchte meine Tochter nicht zusätzlich zu meiner Krankheit noch mit anderen Dingen belasten. Vielleicht schone ich sie ja auch zu sehr. Sie muss sich nur um die Schule kümmern, braucht mir nicht helfen – ich schaue, dass ich den Haushalt alleine mache, langsamer halt als bisher. Ich will alles so normal wie möglich ...«
»Aber Sie sind in einem Ausnahmezustand! Auch wenn Sie das nicht möchten: Ihr Leben ist im Moment nicht normal – was auch immer das heißt. Die Chemotherapien belasten Sie ungemein!«
»Ja, eh ... Aber es gibt Tage, da tu ich wirklich gar nichts«, entschuldige ich mich fast, »... so wie heute. Ich bin so unendlich müde ...«
»Naja, Sie sind doch geduscht, wie ich einmal annehme« – Grinsen – »Sie sind angezogen, zur Bahn gegangen und hergefahren. Haben Sie schon etwas zum z’Morge gegessen?«
»Ich bin ins Lädeli bei mir gleich um die Ecke, frische Brötli für meine Tochter und mich holen – sie hat eine anstrengende Zeit in der Schule. Dann hab ich gschwind unsere Betten abgezogen, damit die Wäsche, während ich bei Ihnen bin, waschen kann – aber das ist ja keine Arbeit, das macht die Maschine. Dann hab ich Dommi zu ihrem Zug gebracht und bin nach Bern und hab was besorgt gleich um die Ecke vom Bahnhof. Jetzt bin ich hier.«
»Gschwind dies, gschwind das, gschwind jenes ... Frau Knoll!«, sagt er mit freundlich-zurechtweisendem Ton. »Für andere ist das ein Tagesprogramm. Es ist zehn Uhr morgens, wenn ich Ihnen zuhöre, werde ich müde! Das nennen Sie gar nichts getan?«
»Ja, das nenne ich so! Davon kann ich doch nicht schon so fertig sein!«
Der Onkologe wird ernst: »Frau Knoll – Sie haben jetzt die fünfte Chemo-Infusion im Blut. Ihnen sind die Haare ausgegangen. Sie haben Albträume vom Onkovin, Ihnen wird übel vom Gestank Ihres Körpers. Sie können tagelang nichts essen wegen der Speiseröhren-Entzündung. Sie bekommen eine der am schwersten verträglichen Therapien, weil Sie noch jung sind.«
Ich muss ihn unterbrechen. Ich spüre Tränen stechend hinter den Augäpfeln aufsteigen. Nur kein Selbstmitleid. Heulen bringt nichts. »Ich hab Sie nicht verstanden – können Sie das bitte wiederholen?« Ich grinse ihn an.
»Was?« »Das mit dem jung sein. Weil fühlen tu ich mich wie 183 ...«
»Sie sind jung für diese Art von Krebs. Sie sind« – er blättert in den Akten – »gerade einmal 43 Jahre alt. Üblicherweise haben alte Menschen ein Non-Hodgkin-Lymphom. Deshalb erhalten Sie die volle Ladung Zytostatika, die weniger robuste Menschen als Sie es sind gar nicht vertragen würden.«
»Ich vertrag’s schon, aber ich ertrag’s nicht mehr. Deshalb wollt ich heute einen Termin bei Ihnen. Ich mag nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin todmüde. Ich hab keinen Appetit – und glauben Sie mir, Herr Doktor: wenn mir einmal der Appetit vergeht, steht die Welt nicht mehr lang. Ich wache jede Nacht mehrfach schweißgebadet auf, oft bin ich zu schwach, mir einen Tee zu machen, dabei muss ich ja viel trinken, damit das Zeug ausgeschwemmt wird. Ich bin so unendlich müde.«
Читать дальше