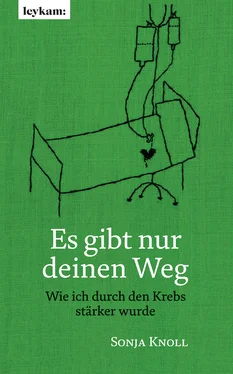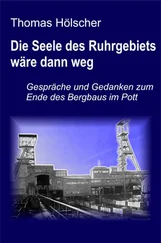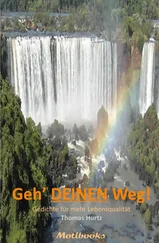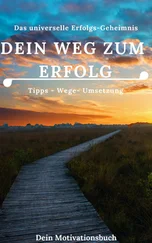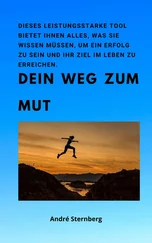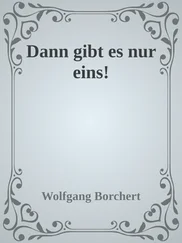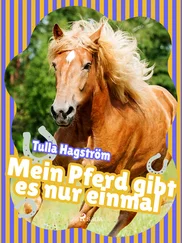In der Schweiz gibt es so gut wie keine stichhaltigen Gründe, um ein Kind auch nur für einen einzigen Tag aus dem Unterricht zu nehmen. Der Lehrer ist ehrlich erschüttert. Selbstverständlich soll ich mit Dominique nach Wien fliegen. Er umarmt mich.
Dann muss ich nach Hause, zu Dommi, in die Wohnung. Ich, die sonst nie langsam gehen kann, die immer ins Rennen und Hetzen kommt, muss mir Zeit lassen, damit Sylvia, die auch erst mit dem Zug heimfährt, etwa gleichzeitig mit mir ankommt. Die letzten Meter kann ich meine Beine kaum vom Boden heben. Es ist wie in einem Albtraum, einerseits will ich weiterkommen, andererseits kann ich mich nur im Zeitlupentempo bewegen.
Wie soll ich es Dommi sagen?
Ich werde Dommis entsetzte Augen nie vergessen.
Mit einem Schrei – »Mami!« – springt sie auf und rennt aus der Wohnung. Ich fühle mich ohnmächtig und hilflos. Mir wird schlecht. Mein Herz klopft ohnehin seit Minuten zum Zerspringen. Ich bin zu schwach, um aufzustehen und ihr nachzugehen.
Meine Freundin Sylvia, in dieser Situation – und in all den folgenden Jahren – eine liebevolle, zuverlässige, unterstützende Freundin, sagt, ich solle sie besser einen Moment alleine lassen.
Tausend Gedanken jagen einander in meinem Hirn: meine Tochter ist 13 Jahre alt und in der Pubertät. Ich erinnere mich sehr ungern an diese Zeit in meinem Leben, die geprägt war von Unsicherheit, Scham und von erster, zaghaft aufkommender Kritik an den bestehenden Verhältnissen und den Eltern, was damals sofort im Keim erstickt wurde mit den Worten, die als Befehl gemeint waren:
»Nur keine Wellen!«
In dieser ohnehin schwierigen Phase der Selbstfindung, der Zweifel und aller möglicher Ungewissheiten, in dieser Phase des Unverstandenseins von den Eltern – in diesem Fall der Mutter, weil ich Dominique alleine erziehe – , in dieser Phase der Stimmungsschwankungen und des Gefühlschaos, mitten in dieser sensiblen Lebensphase platzt nun eine Bombe.
Ich fühle Schuldgefühle und schlechtes Gewissen sich in mir als Klumpen in meinem Herzen aufbauen, den ich viele Jahre mit mir herumschleppen und an dem ich lange leiden werde. Ich muss meine Tochter, die ich doch liebe und die ich vor den Härten des Lebens beschützen möchte, mit meinem Krebs schockieren, ich muss sie belasten mit meiner Krankheit, die möglicherweise bald zu meinem Tod führt. Ich bin so müde.
Als Dominique irgendwann wiederkommt, nehmen wir einander in die Arme. Wir haben keine Tränen. Es ist noch zu früh. Wir halten einander lange fest. Dann beginnt Dommi zu fragen. Doch ich kann immer nur antworten: »Ich weiß es nicht.«
Später setzen wir uns zusammen vor den Fernseher und schauen gemeinsam Dommis Lieblingssendung »Gute Zeiten, schlechte Zeiten.«
Life must go on.
Die Entnahme des Lymphknotens hat gezeigt, dass ich ein Lymphom habe, ein niedrig malignes, heißt: es wächst langsam, und dass es sich »in einem fortgeschrittenen Stadium befindet«. Als nächstes muss in einer Operation untersucht werden, wie weit der Krebs sich in mir ausgebreitet hat. Ganz schlecht wäre es, wenn er schon das Knochenmark angegriffen hätte.
Diese Untersuchung hat den Ruf, sehr schmerzhaft zu sein. Ich bin nervös, fahre am Morgen mit der Bahn ins Spital. Ich habe das Angebot einer Freundin abgelehnt, mich zu begleiten – so schlimm wird’s nicht werden. Und ich bin schon mit so vielem allein fertig geworden. Da muss sie nicht ihren freien Tag opfern.
Der Arzt, der erste der beiden Onkologen, weht weißmantelig heran, würdigt mich kaum eines Blickes. Beim letzten Besuch in seiner Ordination hat er gefragt, wie es mir gehe. Auf meine Nachfrage, ob er psychisch oder physisch meine, war seine Antwort: »Psychisch interessiert mich nicht«. Ich werde mir einen anderen Arzt suchen. Jetzt, vor dem Eingriff, erklärt er mir ungern und knapp die Details der Beckenkamm-Stanzung. Nach einer örtlichen Betäubung wird mittels einer Hohlnadel ein ca. 2 cm langer Zylinder aus dem Beckenknochen gestanzt und das Knochenmark später mikroskopisch untersucht. Daran wird man sehen können, wie weit fortgeschritten der Krebs ist.
Auf dem Bauch liegend höre ich, wie er den Schwestern Anweisungen gibt. Nach dem kurzen Stich der Lokalanästhesiespritze spüre ich nichts mehr, nur hin und wieder einen leichten Druck auf das Becken. Eine der Schwestern steht neben mir, legt mir ihre Hand auf den Arm, und berichtet mir auf meine Bitte hin, was hinter beziehungsweise in meinem Rücken vor sich geht. Ich will immer alles genau wissen.
Sie kommentiert: Jetzt wird überprüft, ob die Anästhesie wirkt, jetzt wird die Spezialnadel hergerichtet, jetzt sticht der Arzt in die Haut über dem Beckenkamm, jetzt muss er kräftig drücken und drehen, um den Knochen anzubohren. Ich höre ihn atmen. Die Krankenschwester an meiner Seite kann sich einen leisen Kommentar nicht verkneifen: »Das ist die einzige Gelegenheit, bei der man Onkologen bei der Arbeit schwitzen sehen kann ...« Alle haben es mitbekommen, denn es ist sehr still im OP, ich höre gedämpftes Lachen hinter den grünen Gesichtsmasken.
Der Arzt klingt ein bisschen verzweifelt: »Mein Gott, sind das harte Knochen!« Ich murmle in die Liege: »Österreichische Nachkriegsqualität.«
Dann geschieht eine Zeitlang nichts. Ich spüre keinen Druck mehr auf den Knochen, die Schwestern scheinen sich leise über irgendetwas zu unterhalten, was mit der Operation nichts zu tun hat. Der Onkologe entfernt sich ein paar Schritte von der Liege, die Atmosphäre hat sich merklich entspannt. Was ist los? Ist es schon vorbei, darf ich aufstehen?
»Nein«, erklärt mir meine »Beruhigungsschwester«, es ist noch nicht vorbei, aber der schwierigste Teil ist geschafft, »die Hohlnadel steckt nun in Ihrem Beckenknochen.« Ja – und jetzt? Mittagspause?
»Jetzt müssen wir alle kurz warten, bis jemand mit einem speziellen Behälter kommt, um das Knochenmark, wenn es dann aus dem Körper gezogen werden wird, sofort zu kühlen. Die Kühltasche wird erst bestellt, wenn die Nadel im Knochen steckt.«
Ich möchte mir nicht vorstellen, wie die Szene von außen betrachtet wirkt: ich liege auf dem Bauch, aus dem Rücken ragt eine lange Nadel, rundum heitere Gespräche.
Eines muss ich sagen: So völlig unsensibel sich der Onkologe im persönlichen Umgang mit mir erwiesen hat, so begabt scheint er auf technischem Gebiet zu sein. Ich habe von diesem gefürchteten Eingriff gar nichts gespürt. Später wird mir eine der Schwestern in allen Punkten Recht geben: der Arzt sei ein Holzklotz im persönlichen Umgang, aber bei dieser OP könne ihm keiner das Wasser reichen.
Als die Türe zum OP sich öffnet, ist plötzlich die anfängliche Konzentration wieder da. Es geht jetzt schnell, und ein kleiner Teil meines Rückenmarks wird gekühlt abtransportiert. Jetzt können wir alle aufatmen, es ist gut gegangen.
Ich möchte sofort aufstehen – es ist ja vorbei –, aber die Krankenschwester rät mir, es langsam angehen zu lassen. Immerhin sei das gerade ein Eingriff gewesen. Aber ich bin doch stark, so etwas kann mir doch nichts anhaben. Dennoch bleibe ich halt noch liegen. Wenn ich schon nicht aufstehen soll, möchte ich mir – weil ich ja immer alles genau wissen will – wenigstens noch diese spezielle Hohlnadel anschauen.
Das war keine gute Idee. Als ich die blutverschmierte lange Metallnadel sehe, und mir vorstelle, wie die in mich gebohrt wurde, wird mir flau im Magen. Mit einem Mal beginne ich unkontrolliert zu zittern.
Die Krankenschwester legt ihre warmen Hände auf meinen Rücken und redet beruhigend auf mich ein. Wieder einmal habe ich meine Nervenstärke überschätzt. Mit einem Mal bin ich sehr dankbar dafür, dass mein lieber Freund Fritz darauf bestanden hat, mich nach dem Eingriff mit dem Auto nach Hause zu bringen. Wahrscheinlich wartet er schon draußen auf dem Gang.
Читать дальше