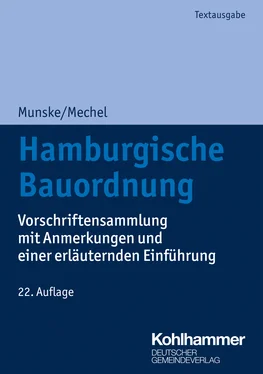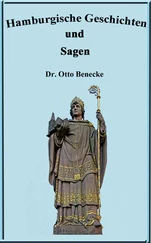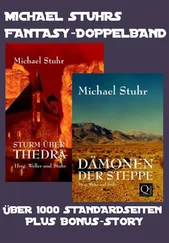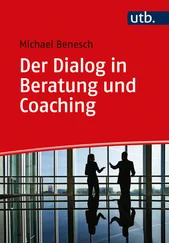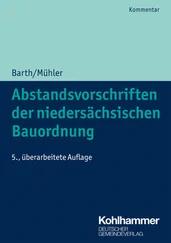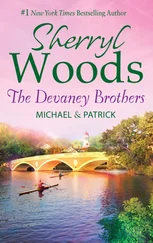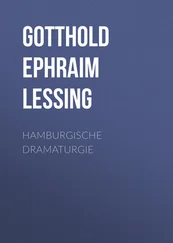Das öffentliche Baurecht wird mit dem Bauplanungsrecht und dem Bauordnungsrecht durch zwei große Rechtsbereiche gebildet. Während das Bauplanungsrecht als Recht der Bodennutzung festlegt, ob eine bestimmte Nutzung von Grund und Boden zulässig ist, regelt das Bauordnungsrecht – verkürzt gesagt – die zur Gefahrenabwehr notwendigen Anforderungen an das einzelne Bauwerk unter Einbeziehung seiner engeren Nachbarschaft. Das Bauordnungsrecht enthält mithin alle öffentlich-rechtlichen Anforderungen, die beim Errichten, Nutzen, Ändern und Abbrechen einzelner baulicher Anlagen beachtet werden müssen, um so einer möglichen Gefährdung von Menschen und Sachgütern sowie der natürlichen Lebensgrundlagen vorzubeugen, unzumutbare Belästigungen zu vermeiden und sozialen und baupflegerischen Belangen zu genügen.
Im Gegensatz zum Bauplanungsrecht, das als sog. Bodenrecht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 Grundgesetz (GG)) der Gesetzgebungskompetenz des Bundes unterfällt (siehe Nr. 10 dieser Einführung), stellt das Bauordnungsrecht einen der wichtigsten Rechtsbereiche in der Gesetzgebungskompetenz der Bundesländer dar. Die Regelungen des Bauordnungsrechts bestimmen nämlich ganz wesentlich die konkrete Gestaltung baulicher Anlagen und damit das Stadt- und Ortsbild. Insofern betrifft das Bauordnungsrecht jede Bewohnerin und jeden Bewohner der Stadt. Natürlich hat das Bauordnungsrecht eine hohe Bedeutung für alle Bauherren von Neubau- oder Modernisierungsvorhaben und für die – von Berufs wegen – am Baugeschehen Beteiligten, wie Architekten, Bauingenieure, Bauleiter und Bauunternehmer, aber auch für die mit der Herstellung von Bauprodukten befasste Industrie. Es ist schließlich für alle von Interesse, die Grundstücke und bauliche Anlagen nutzen oder verwalten, namentlich die Grundeigentümer selbst.
In Hamburg ist das Bauordnungsrecht im Wesentlichen in der Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 geregelt.
Neben der Hamburgischen Bauordnung ist als ein weiteres landesrechtliches Gesetz mit unmittelbarem Bezug auf das Bauordnungsrecht das Gesetz zum Abkommen über das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt-Abkommen) von 1992 zu nennen. Neben die Bauordnung und dieses Gesetz treten noch 12 weitere vom Senat erlassene, das Bauordnungsrecht betreffende Rechtsverordnungen (C 1–12 in diesem Band sowie Nr. 7.1 der Einführung) sowie weitere 13 auf der Bauordnung beruhende Gestaltungsverordnungen (s. Nr. 7.1 der Einführung, C 13–18 in diesem Band und Anmerkung zu § 12).
Die ersten bauordnungsrechtlichen hamburgischen Regelungen im modernen Sinne wurden nach dem Großen Brand von 1842 erlassen. Sie betrafen allerdings nur das durch den Brand verwüstete Stadtgebiet. Es folgten das Baugesetz vom 3.7.1865, das Baupolizeigesetz vom 23.6.1882 und die Bauordnung für die Stadt Hamburg vom 19.7.1918. Die Vorschriften galten nur im Bereich des Stadtgebietes von Hamburg, nicht aber in den hamburgischen Landgebieten.
Erst die Baupolizeiverordnung (BPVO) vom 8.6.1938, die später mehrfach geändert und 1961 erneut bekanntgemacht wurde, galt im gesamten hamburgischen Staatsgebiet. Sie enthielt außer bauordnungsrechtlichen Regelungen u. a. auch Festlegungen über die zulässige Art und das zulässige Maß der baulichen Nutzung von Grundstücken, und damit auch bauplanungsrechtliche bzw. städtebauliche Regelungen. Diese haben auch heute noch Bedeutung für die planungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben in Gebieten mit übergeleiteten Bebauungsplänen aus der Zeit vor 1960, insbesondere für Gebiete mit Baustufenplänen (siehe D 3 in diesem Band und Nr. 13 und 14 dieser Einführung). Hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Regelungen wurde die Baupolizeiverordnung durch die Hamburgische Bauordnung von 1969 ersetzt.
Diese wurde durch die Hamburgische Bauordnung von 1986 abgelöst. Ergänzt durch das Hamburgische Wohnungsbauerleichterungsgesetz vom 4.12.1990 – es führte das vereinfachte Genehmigungsverfahren ein –, die Bauanzeigenverordnung vom 18.5.1993 – sie führte das Bauanzeigeverfahren ein –, die Baufreistellungsverordnung vom 5.1.1988 – sie nannte die Vorhaben, die keiner präventiven Genehmigung bedürfen – sowie das Gesetz über die Höhe des Ausgleichsbetrages für Stellplätze und Fahrradplätze galt die Hamburgische Bauordnung von 1986 bis zum Inkrafttreten der neuen Hamburgischen Bauordnung vom 14.12.2005 am 1.4.2006.
Mit der neuen Hamburgischen Bauordnung wurde das Hamburgische Bauordnungsrecht gestrafft, vereinfacht und umfassend dereguliert.
3.Erlass der Hamburgischen Bauordnung von 2005; Änderungen der Bauordnung seit 2005
3.1Die neue Hamburgische Bauordnung wurde als Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft – Drucksache 18/2549 – in das Parlament eingebracht. Der federführende Stadtentwicklungsausschuss legte die Vorlage mit der Berichtsdrucksache 18/3230 am 2.12.2005 dem Plenum der Bürgerschaft vor. Am 7.12.2005 wurde das Gesetz unter Annahme der Empfehlungen aus der Drucksache 18/3230 beschlossen.
3.2Mit dem Gesetz zur Sicherstellung klimaschutzrechtlicher Anforderungen im Baugenehmigungsverfahren vom 17.2.2009 (GVBl S. 43) wurde die Bauordnung an die Erfordernisse des Klimaschutzes angepasst. Durch Änderung des § 68 HBauO wurde die Prüfung energetischer Standards der Hamburgischen Klimaschutzverordnung und der Energieeinsparverordnung im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren ermöglicht. Dazu wurde die Energieeinsparung in § 68 Abs. 1 HBauO, in § 68 Abs. 2 HBauO (vereinfachtes Genehmigungsverfahren) und in § 68 Abs. 4 HBauO (Baugenehmigungsverfahren mit Konzentrationswirkung; nunmehr ebenfalls in § 68 Abs. 2 HBauO geregelt) jeweils als neues Prüfthema hinzugefügt. Ausgenommen sind lediglich Gebäude der Gebäudeklasse 1 sowie bestimmte Fallgruppen von Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 im Anwendungsbereich des vereinfachten Genehmigungsverfahrens. Das Gesetz enthielt im Übrigen die notwendigen Änderungen der Bauvorlagenverordnung, der Prüfverordnung und der Baugebührenordnung.
3.3Die Änderung der Bauordnung durch das Gesetz vom 24.11.2009 (GVBl S. 402) wurde aufgrund einer Besonderheit des hamburgischen Wegerechts erforderlich. Die öffentlichen Wege in Hamburg stehen im öffentlichen Eigentum. Aus diesem Grund kann an diesen Flächen keine Baulast bestellt werden. Mit der Änderung des § 79 Abs. 1 HBauO wurde klargestellt, dass in Fällen von öffentlichem Eigentum an einer Grundfläche eine Baulast (z. B. in Fällen des § 7 HBauO oder des § 48 HBauO) durch die Erteilung einer vergleichbar dauerhaften Sondernutzungserlaubnis, den Abschluss eines entsprechenden Sondernutzungsvertrages bzw. die Erteilung einer vergleichbaren öffentlich-rechtlichen Gestattung ersetzt werden kann.
3.4Auswirkungen auf die Hamburgische Bauordnung hatte auch das Hamburgische Gesetz zur Umsetzung der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie und über weitere Rechtsanpassungen vom 15.12.2009 (GVBl S. 444). Mit dem Gesetz wurde § 67 HBauO über die Bauvorlageberechtigung an die Anforderungen der Dienstleistungsrichtlinie angepasst. Anpassungen waren dabei nur im Bereich der sog. beschränkten Bauvorlageberechtigung für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 erforderlich. Es wurde eine Regelung aufgenommen (§ 67 Abs. 3 Satz 2 HBauO), nach der Personen aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften oder nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellter Staaten für diese Wohngebäude bauvorlageberechtigt sind, sofern sie über eine Ausbildung verfügen, die den in § 67 Abs. 3 Satz 1 HBauO genannten Ausbildungen gleichwertig ist. Im Hinblick auf die unbeschränkte Bauvorlageberechtigung nach § 67 Abs. 2 HBauO waren Änderungen in der Bauordnung nicht erforderlich. Die Hamburgische Bauordnung nimmt nämlich insoweit vollen Umfangs auf die Regelungen des Hamburgischen Architektengesetzes und des Hamburgischen Gesetzes über das Ingenieurwesen Bezug. Die Änderung der Regelungen zur Bauvorlageberechtigung wurde überdies zum Anlass genommen, in § 67 Abs. 2 Nr. 2 HBauO die Bezugnahme auf das Hamburgische Gesetz über das Ingenieurwesen zu aktualisieren und in § 67 Abs. 5 HBauO die bisher verwandte Berufsbezeichnung „Garten- und Landschaftsarchitektinnen und –architekten“ an die im Hamburgischen Architektengesetz verwandte neue Berufsbezeichnung „Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten“ anzupassen.
Читать дальше