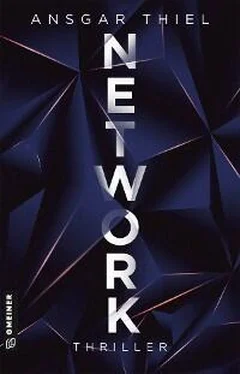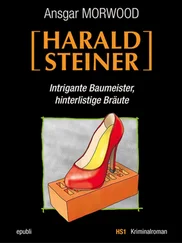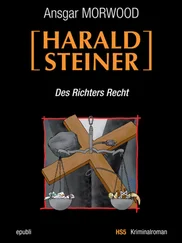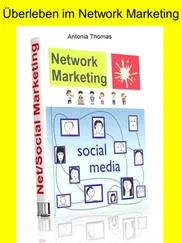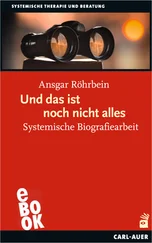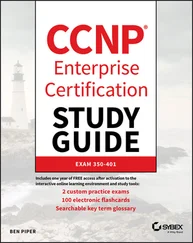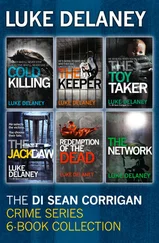Eine Zeit lang warf er fast sein gesamtes Taschengeld in die Musikbox, was nicht nur die Bargäste ärgerte, sondern auch seinen Bruder so sehr nervte, dass er ihm die CD schließlich schenkte, unter der Bedingung, sie nur zu Hause zu hören und seinen Eltern damit auf den Geist zu gehen.
Er las die einzige der E-Mails, die ihn interessierte. Heute waren es zwei Identitäten, die es zu eliminieren galt. Eine Art Arzt und einen Entertainer – sein erster. Bei dem Gedanken, dass es im Netz Entertainer gab, die sich auf virtuellen Bühnen zum Affen machten, musste er grinsen.
Er lockerte seine Finger und schloss den mit einem Zufallsmodus arbeitenden Code-Identifikations-Scanner an seinen Computer an. Die Überwindung der ersten Sicherungssperre der Netzverwaltung war Routine. Das Sicherungssystem basierte auf einem Algorithmus, den er selbst vor Jahren für den EU-Verteidigungsrat konzipiert hatte. Der Weg durch das verminte Gelände erforderte nur wenige geschickte Ausweichbewegungen.
Die zweite Sperre war schon etwas angemessener für jemanden aus der oberen Hackerriege: ein auf den ersten Blick vollkommen amorphes, chaotisches System von Abschirmmechanismen, das zu durchdringen kaum möglich erschien. Doch auch hierfür brauchte er nur knapp zwei Minuten. Man muss nur das Prinzip kennen, dachte er. Einem seiner Techniker hatte er es einmal, um Nachvollziehbarkeit bemüht, so erklärt, dass sich die Komplexität eines chaotischen Systems durch die Einleitung eines sogenannten Resonanzeffekts reduzieren lasse, indem mehrere unterschiedliche elektromagnetische Schwingungsmuster erzeugt würden, die jeweils eine Anziehungswirkung auf alle ähnlich schwingenden Abschirmmechanismen ausübten, diese zu molekülähnlichen Komplexen ballten und damit eine durchlässige Ordnung schufen.
Der Techniker, ein kleiner, etwas ausgemergelter rotblonder Ire mit verkniffenem Gesicht, hatte ohne eine Miene zu verziehen zugehört, ihn dann skeptisch angesehen, den Kopf geschüttelt und wortlos den Raum verlassen.
Nachdem ZZZ die Sperren überwunden hatte, startete er den Access-Modus, klebte sich die beiden Elektroden, die auf einem kleinen aluminiumfarbenen Nachttisch rechts neben seiner Arbeitsplatte lagen, an die Schläfen, drückte auf den roten Knopf unterhalb der rechten Armlehne seines Schreibtischstuhls, sodass dieser sich in eine Ruheliege verwandelte, machte es sich bequem und schloss die Augen.
Aufgrund der für den Eingang in die virtuelle Realität typischen primären Sinnesüberreizung, die durch den Aufbau elektrischer Potenziale in der Großhirnrinde erzeugt wurde, leuchtete vor seinem inneren Auge zunächst ein feuerroter Ball auf, der sich langsam, sternförmig in alle Richtungen nach außen wabernd, zu einer hell-orangen Sonne vergrößerte. Dieser Vorgang, Aura genannt, dauerte exakt fünf Sekunden. Dann war er drin.
Er befand sich in der Abflughalle, wie die Mental-Port-Station, in der das Ziel der virtuellen Reise angegeben wurde, im Volksmund genannt wurde. Die Optik der Halle war den Abflughallen großer internationaler Flughäfen des 20. Jahrhunderts nachempfunden, mit dem Unterschied, dass die für diese Orte typischen Menschenmassen fehlten und er sich – beziehungsweise die durchsichtige, unförmige und an eine fassförmige Rauchwolke erinnernde Gestalt, die jeder Ankommende direkt nach dem Access darstellte – alleine in der Halle befand.
Obwohl es in der Abflughalle viele Schalter zu geben schien, war für jeden, der sich in die virtuelle Realität begab, nur ein Display von Relevanz – ein quadratischer Monitor mit einem virtuellen Eingabemikrofon an der rechten Seite. In dieses Mikrofon musste man einen Code eingeben, um entweder die virtuelle Wunschidentität oder – bei Networkern vor Beginn ihres Arbeitstags – die Pflicht-Arbeitsidentität zu registrieren.
ZZZ fand diese unnötige Prozedur albern, die Leute konnten sich einfach nicht von ihren alten Vorstellungen lösen, wie die Wirklichkeit auszusehen hatte.
Für die Eliminierung des Pseudo-Mediziners, der auf eine Art Beratung für gesundes Netzverhalten spezialisiert war, wählte er die Identität einer typischen Netz-Super-Blondine mit rotem Minikleid, comicartigen Riesenbrüsten und Wespentaille, exakt der Typus, auf den seine Zielperson vermutlich abfuhr. Dann gab er die Zielkoordinaten ins Mikrofon ein und flog ab.
Das Beamen von der Abflughalle zum Zielort dauerte im Normalfall 30 Sekunden, warum auch immer, vermutlich um den Leuten ein Reisegefühl zu vermitteln. 30 lange Sekunden. Der ganze Vorgang war ätzend. Man raste durch einen simulierten Tunnel aus silbergrauem Nebel, an dessen Ende sich ein heller Fleck befand. Wenn man ihn überhaupt sah.
Der Tunnel war voller Werbung. Simulierte Standbilder, in allen Farben glitzernd, mit riesigen leuchtenden Buchstaben und Piktogrammen, die sich im Dreisekundentakt aufbauten und einem langsam entgegenflogen, gerade so lange sichtbar, dass man ihre Botschaft nicht ignorieren konnte. Beworben wurden vor allem EA-Produkte – Renten- und Lebensversicherungen, ultraweiche Liegesessel, Ratgeber-Broschüren und dergleichen – Dinge, die man nicht brauchte, und mit denen versucht wurde, den Networkern das Bürgergeld aus der Tasche zu ziehen.
Seit Neuestem wurde sogar für Werbeabwehrsoftware geworben, natürlich ebenfalls von EA, angeboten durch Tochterfirmen. Die Software funktionierte allerdings immer nur maximal einen Monat lang, bevor man das nächste Update kaufen musste. ZZZ hatte eine Weile, als ihn die Werbung so nervte, dass er es nicht mehr auszuhalten glaubte, versucht, eine Werbeabwehrsoftware zu schreiben, die ihn vor diesen elenden Abzockeversuchen schützte.
Nach mehreren gescheiterten Anläufen hatte er resigniert aufgegeben. Dieser Werbescheiß war wie Unkraut, nicht einmal er kam dem Mist dauerhaft bei, außer er investierte sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Zeitressourcen.
An seinem Ziel angekommen, musste er für zehn Minuten in einem sterilen Wartesaal mit Pseudo-Ledersesseln und viertklassigen Landschaftsaquarellen an der Wand ausharren – das typische Wartezimmer eines Arztes, wie es sich in den letzten 50 Jahren kaum verändert hatte. Der einzige Unterschied war die im Vergleich zur Realität etwas grobkörnigere Auflösung dessen, was man sah. Alles wirkte, als sei man ganz leicht weitsichtig und habe keine Brille auf.
So typisch wie die Praxis war der Arzt. Mitte 50, grau melierte Haare, gebräunte Haut, strahlendweiße Zähne, den obligatorischen weißen Kittel offen, eine viereckige silberfarbene Lesebrille auf der Nasenspitze, über deren oberen Rand er wohlwollend und distinguiert zugleich Blickkontakt aufnahm – arztmäßig, wie man es sich nicht besser wünschen konnte – der Doktor, dem die Männer und Frauen vertrauten.
Wohin es seine Blicke zog, war klar. Wie erwartet: ein distinguierter virtueller Titten-Grabscher. Dazu prollige Anzüglichkeiten und Anmach-Gelaber. Herrje. Und jetzt sollte er sich auch noch freimachen. Er musste gleich kotzen. Schluss mit den Präliminarien. ZZZ hatte genug. Messer raus – ein Zug, ein Stich – Auftrag erledigt.
Das Sterben im Netz faszinierte ihn immer wieder. Es gab keine große Show. Die Netzperson, die starb, fror ein – und löste sich einfach langsam auf: Die Konturen verschwammen, die Figur wurde durchsichtig, nahm noch einmal kurz die Rauchgestalt aus der Abflughalle an – und war weg, einfach weg. Die Banalität dieses Vorgangs machte die Sache in gewisser Hinsicht nur noch unheimlicher, suggerierte Bedeutungs- und Sinnlosigkeit.
Was das Ganze sollte, warum Netzidentitäten überhaupt sterben konnten, war im Grunde keinem klar. »Offenhalten von Möglichkeiten« lautete die offizielle Begründung, das heißt, die Eliminierung nicht-zertifizierter Nutzer zu ermöglichen, auf die man nicht direkt zugreifen konnte – Hacker also, solche wie ihn.
Читать дальше