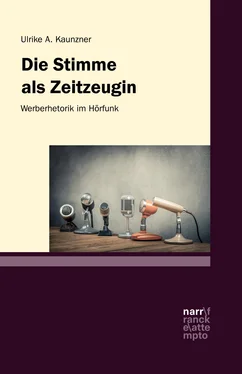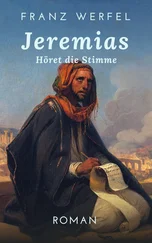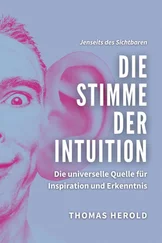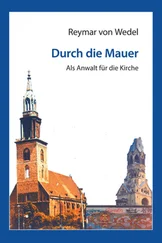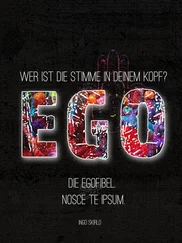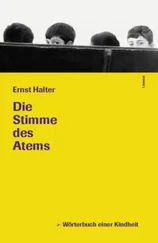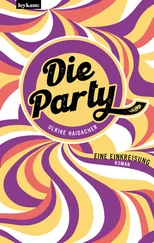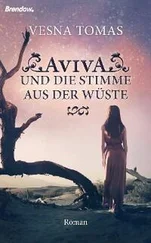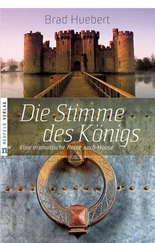1. Phase: Aussendung einzelner Programme über Amplitudenmodulation (AM) auf Lang-, Mittel- und Kurzwelle, die nach dem 1. Weltkrieg begann.
2. Phase: Übergang zur Frequenzmodulation (FM) und Nutzung der Ultrakurzwelle (UKW), später Einbeziehung von Kabel und Satellit. Beginn nach dem 2. Weltkrieg heute noch dominant.
3. Phase: Digitalisierung des Signals und Übertragung terrestrisch (DAB, DRM)3, via Internet oder über Mobilnetze, Anfänge in den 80er Jahren, erste Anwendungen im Regeldienst ab ca. 2000.
Die im vorliegenden Band untersuchte Zeitspanne liegt also noch weit vor der DigitalisierungDigitalisierung und umfasst die Zeit des Aufkommens und allmählichen Ausbreitens des Konkurrenten Fernsehen. Im Hörfunk sind die oben skizzierten technischen Entwicklungsschritte für die Hörer zwar wahrnehmbar, inwieweit sie einen Einfluss auf die Wiedergabe und Wahrnehmung der StimmqualitätStimmqualität und hier in erster Linie auf die Sprechstimmlage haben, ist jedoch schwer zu sagen. In seiner Studie zur Veränderung von Artikulation und Sprechweise kommt Falk (2019, S. 40) in Bezug auf den Wandel der MikrofontechnikMikrofontechnik zu folgender Einsicht: „Konkrete Hinweise bezüglich der Auswirkungen der MikrofontechnikMikrofontechnik auf die zeitspezifische Sprechweise konnten […] nicht festgestellt werden. Die Technikgeschichte des Mikrofons scheint für Erklärungen zur sich verändernden Stimme also insgesamt auszuscheiden.“
Anders zeigt sich jedoch das Bild, wenn man die Studiotechnik Studiotechnik betrachtet. Es macht einen Unterschied, ob das Studio, wie zu Beginn der Radiogeschichte und bis zur stereophonen AufnahmetechnikAufnahmetechnik in den 1960er Jahren, als von Umweltgeräuschen abgeschotteter, fast „steriler“ Raum verstanden wurde, oder ob der Eindruck von Alltagsszenen und alltagsnahem natürlich wirkendem Gesprächston die Richtschnur bei Studioaufnahmen ist. Letzteres wurde mit der Digitaltechnik immer ausgefeilter, da jetzt Nachbesserungen und Modifizierungen stimmlicher Parameter möglich wurden. Dass sich das alles auf den Sprechstil im Radio und die jeweils geltenden Richtlinien zum Mediensprechen auswirkte, wird noch näher betrachtet werden (siehe Kap. 3).
2.1.2 Radiohörgewohnheiten im Spiegel der Zeit
Die Popularität des elektronischen Massenmediums Radio wuchs sprungartig an, was an einer Reihe an Faktoren festzumachen ist: zum einen an technischen Entwicklungen, zum anderen an gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen, welche alle die HörgewohnheitenHörgewohnheiten beeinflussten.
Am Beispiel des Rundfunks kann in historischer Perspektive gezeigt werden, wie sich das Hören vom angestrengten Lauschen mit Kopfhörern vor den Detektorgeräten zum feierlichen, gemeinschaftlichen Zuhören von Konzerten im Familienkreis, bis zum Nebenbei-Hören bei anderen Tätigkeiten zu Hause, als nahezu ubiquitäre Berieselung und seit den Transistorgeräten und dem ‚walk-man‘ zum individuellen Überall-Hören wandelte. (Marßolek & Saldern, 1999, S. 13–14)
Nach dem Zweiten WeltkriegWeltkrieg, Zweiter änderte sich also die Situation rund um den Rundfunk und die Sendeanstalten drastisch, was neue Hörgewohnheiten von Seiten der Bevölkerung nach sich zog und nicht zuletzt eine Veränderung im Standard des MediensprechensMedien-sprechen und des SprechgestusSprechgestus von Seiten der Mediensprecher bewirkte (Kap. 3). Die Umstellung auf den UKW-Rundfunk in Deutschland war ein Produkt langwieriger politisch und technisch motivierter Wellenkonferenzen nicht nur in Deutschland, sondern europaweit.1 Rundfunksender, die ihre Programme vorher ausschließlich über Amplitudenmodulation (AM) ausgestrahlt hatten, stiegen in den Jahren nach dem Krieg nach und nach auf UKWUKW um, und die Entwickler der Radiogeräte zogen nach, in dem die Geräte für den UKW-Empfang ausgestattet wurden.
Die Menschen in der Zeit des Wirtschaftswunders konnten sich nun UKW-Empfangsgeräte leisten, zunächst in Form einer Nachrüstung mit UKW-Zusatzgeräten2, die man in die herkömmlichen Radioapparate einbauen konnte. Die Hördauer stieg infolgedessen auf 2–3 Stunden am Tag (Krug, 2010, S. 22) und erlangte eine solche Popularität, dass laut Seegers (1999, S. 167) über die Hälfte der Rundfunkteilnehmer im Jahre 1955 ein solches Gerät besaßen.
Einschneidend für die HörgewohnheitenHörgewohnheiten der Menschen war schließlich vor allem die Entwicklung des TransistorradiosTransistor-radio, eines Empfangsgeräts, das mit Transistoren, kleinen Halbleiterelementen, ausgestattet war. Es löste das herkömmliche Röhrenradio mit seinen schweren Elektronenröhren ab. Die Umstellung in Westdeutschland erfolgte nach Fickers (1998) in zwei großen Wellen, die man grob so skizzieren kann, dass in einer ersten Welle (1950–1955) die Röhrenradios zusätzlich mit Transistoren ausgestattet wurden, in einer zweiten Welle (1960–1965) die Röhren in den Empfängern durch Transistoren ersetzt wurden.
Transistorradios waren tragbare Kofferradios, die das Radiohören vor allem flexibler machten. Mitte der 1950er Jahre waren die ersten Modelle als Mittelwellenempfänger schon im Handel erhältlich, aber erst nach der Weiterentwicklung zum UKW-Empfänger war der enorme Markterfolg des neuen Geräts unbestritten. Die Folge war eine Revolution der HörgewohnheitenHörgewohnheiten in den 1960er Jahren. Man konnte nun fast überall Radio hören und das eigene Koffer- oder Taschenradio mitnehmen, denn es war nicht mehr wie ein Möbelstück einem Zimmer in der Wohnung zugewiesen. Jetzt wurden auch die ersten Autoradios mit Transistoren vertrieben, was in den früheren Jahrzehnten abgesehen von der unhandlichen Größe der ersten Geräte unerschwinglich war. Auch diese neue Hörsituation während des Autofahrens erweiterte das Programm-AngebotProgramm-Angebot der Rundfunksender.
Die späten 1950er und die Jahre danach waren von Seiten der Konsumenten folglich dadurch gekennzeichnet, dass sich die Hörer nicht mehr wie vorher zum Radioapparat begeben mussten, jetzt war er zu ihrem „Begleiter“ geworden, der sie gezielt und überall ihre Lieblingssendungen anhören ließ. Für die Radiosender bedeutete das, dass sie mehr Abwechslung bieten mussten, zumal das FernsehenFernsehen, der große Konkurrent des Radios, ab den 1960er Jahren die Wohnzimmer zu erobern begann und die Gewohnheiten des Medienkonsums erneut veränderte. Laut Krug (2010, S. 23) sank daher die abendliche Einschaltquote der Mittelwellensender von 50 % zu Beginn der 1950er Jahre auf unter 20 % zehn Jahre später.
Neue Sender, das sogenannte PopRadioPop- und ServiceradioRadioService, modifizierten ab den 1970er Jahren als Antwort auf die räumliche Unabhängigkeit der Radiohörer durch ihre diversifizierten Angebote und Begleitprogramme wiederum die Hörgewohnheiten. Sie richteten sich jetzt an den Individualhörer mit eigenem Gerät, nicht mehr nur an häusliche Hörer, die ihr Radio bewusst einschalteten.
Ab den 1980er Jahren schließlich revolutionierte der PrivatfunkPrivatfunk die Senderlandschaft nochmals, jetzt machte sich das duale SystemDuales System auch im Hörfunk breit und ließ die regionalen Sender erstarken. Eine Sender- und Programmfülle war und ist die Folge, die Öffentlich-RechtlichenSenderöffentlich-rechtliche sahen und sehen sich heute vor der Herausforderung, sich zum einen abzugrenzen und zum anderen ihre Attraktivität zu erhöhen, was einen starken Konkurrenzkampf gegenüber den privaten Sendern hervorruft.
Trotz der räumlichen Mobilität beim Radiohören, die sich in den skizzierten Jahrzehnten immer mehr durchsetzte, lag der nächste Schritt noch in der Zukunft: die zeitliche Flexibilität. Es wurde also bis in die 1980er Jahre zu bestimmten Zeiten gehört, da es noch kein Programm „on demand“ gab; das sollte erst mit der nun aufkommenden DigitalisierungDigitalisierung möglich werden.
Читать дальше