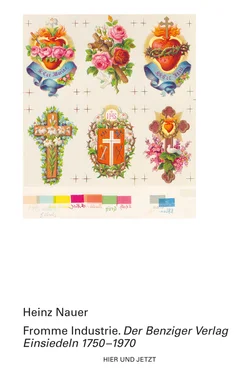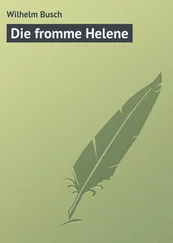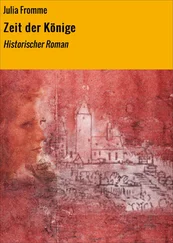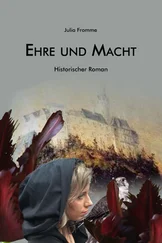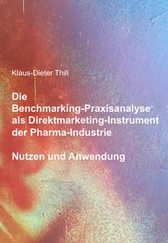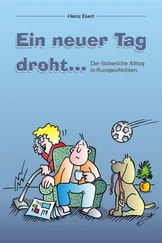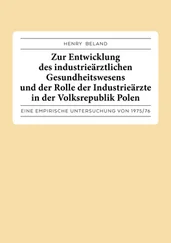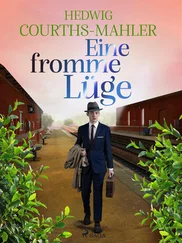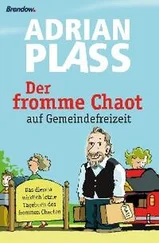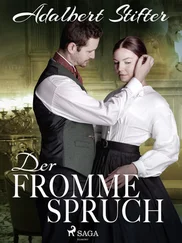Robert Kistler spricht in seiner Wirtschaftsgeschichte des Kantons Schwyz von durchschnittlich 800 Angestellten in den Jahren von 1880 bis 1900. 149Odilo Ringholz zählte 1896 nahezu 900 Arbeiter. 150Auch in den Verlagskatalogen selbst findet sich in den 1880er-Jahren hin und wieder die Zahl von 900 Angestellten. 151In einem kurzen Artikel der Zeitung «Vaterland» über Adelrich B.-Koch aus dem Jahr 1885 heisst es, der Verlag habe «zu seinen Blüthezeiten» über 900 Angestellte gehabt. 152
Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass der Generationenwechsel in der Verlagsleitung und vor allem die Einführung einer eigenen Druckerei die Zahl der Angestellten ab etwa 1830 stark ansteigen liess und diese sich innerhalb von zwanzig Jahren von ein paar Dutzend auf rund 500 Personen erhöhte. Ab 1860 stieg die Angestelltenzahl noch einmal an und dürfte zu Spitzenzeiten in den 1870er- und 1880er-Jahren die Zahl von 900 übertroffen haben. Die überlieferten Verzeichnisse stützen diese Zahl. Im Jahr 1900, zu einem Zeitpunkt, als man die Angestelltenzahl bereits etwas reduziert hatte, zählte der Verlag in Einsiedeln und Umgebung immer noch 808 Angestellte. 153
Diese Zahlen betreffen lediglich das Geschäft in Einsiedeln. Nicht berücksichtigt sind die Filialen in den USA, für die keine Zahlen überliefert sind. Da die Filialen im 19. Jahrhundert nie eigene Druckereien einrichteten, dürften sie auch deutlich weniger Personal beschäftigt haben. Allerdings betrieb man in Cincinnati schon in den 1860er-Jahren eine Buchbinderei und in New York ein Atelier für Kirchenornamente, das 1894 zu einer Fabrik ausgebaut wurde. Eine Zahl von sicherlich über 100, vielleicht auch 300 oder 400 Angestellten in den US-amerikanischen Filialen scheint für die letzten drei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts realistisch.
Ende der 1860er-Jahre stellte der Benziger Verlag auch in der Buchbinderei vollständig auf fabrikmässigen Betrieb um. Bis dahin hatte man stets einige der Arbeiter in traditioneller Heimarbeit beschäftigt. Unklar ist, ob der Verdienst im Verlag für diese Arbeiter, die Rosenkranzkettlerinnen oder die Kinder, die Heiligenbilder kolorierten, ein Haupteinkommen war oder lediglich ein Nebeneinkommen zu einer Tätigkeit in Landwirtschaft, Textilindustrie oder einem anderen Gewerbe.
Auch zur Herkunft der Kinder fehlen genaue Informationen. Es ist möglich, dass Mitglieder der Verlegerfamilie, die sich in verschiedenen Ämtern im Schul- und Armenwesen sozialpolitisch betätigten und 1869 an der Errichtung einer Erziehungsanstalt für Knaben beteiligt waren, Kinder direkt aus diesen Institutionen rekrutierten. Kinderarbeit war im Unternehmen auch in den 1870er-Jahren noch verbreitet und wurde erst im Vollzug des Fabrikgesetzes von 1877 eingestellt, das die Fabrikarbeit von Kindern unter 14 Jahren verbot. 154
Die meisten Arbeitskräfte des Benziger Verlags in Einsiedeln stammten aus der Region: Um 1890 stammten rund sechzig Prozent aller Angestellten aus dem Kanton Schwyz, die allermeisten davon aus dem eigenen Bezirk. 155Auch die amerikanischen Filialen rekrutierten ihr Personal häufig in Einsiedeln. Ab Mitte der 1860er-Jahre bestand dort eine zunehmende Nachfrage nach deutschsprachigen Arbeitskräften, die man in Einsiedeln und Umgebung rekrutierte und in die USA sandte. Erst etwa ab 1880 fanden die Filialen ihr Personal vor Ort.
Betrachtet man die drei Indikatoren gesamthaft, so zeichnet sich eine gesteigerte geschäftliche Betriebsamkeit ab den 1850er-Jahren ab: Die Zahl der Angestellten erhöhte sich markant, es erfolgte der Ausbau der Fabrikationsgebäude, die ersten eigenen Filialen in den USA und die Stahl- und Kupferdruckerei wurden errichtet sowie manch weitere Neuerung eingeführt. Es gibt vielfältige Gründe für diesen Aufschwung in der Jahrhundertmitte. Man darf annehmen, dass die Gründung des schweizerischen Bundesstaats – und damit verbunden die Abschaffung von Binnenzöllen, ein besseres Postwesen und die Vereinheitlichung des Münzwesens – sich günstig auf die Entwicklung des Geschäfts auswirkte; ebenso die fortschrittsoptimistische Stimmung der «Schweiz des Freisinns» 156in den Jahrzehnten nach der Bundesstaatsgründung von 1848. 157Mit den Quellen aus dem Verlagsarchiv belegen lässt sich dies freilich nicht. Die Neuerungen im jungen Bundesstaat finden dort kaum je Erwähnung. Auch war die Firma Benziger schon damals so stark auf den deutschen und zunehmend den US-amerikanischen Markt ausgerichtet, dass die institutionelle Integration des schweizerischen Binnenraums kaum die entscheidenden Impulse für das Wachstum gegeben haben dürfte. 158
Ein gewichtiger Grund für die Geschäftsausdehnung ab der Jahrhundertmitte dürfte darin liegen, dass die westeuropäische Bevölkerung zunehmend alphabetisiert wurde. Das konnte dem Absatz auch von religiösen Büchern, Kalendern und Zeitschriften nur förderlich sein. 159Überhaupt erlebte die religiöse Literatur im Zuge eines allgemeinen religiösen Revivals ab dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts ein bemerkenswertes Comeback. Nachdem sie in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts von der «Schönen Literatur» überflügelt worden war, was die Zahl der Neuerscheinungen betraf, zählte die religiöse Literatur zwischen 1850 und 1870 vorübergehend wieder die meisten Neuerscheinungen im deutschen Buchhandel. 160
Auf regionaler Ebene war der Aufschwung der Wallfahrt und die internationale Bedeutung des Klosters sicherlich förderlich. Auch firmeninterne Gründe dürfen nicht ausser Acht gelassen werden. In den 1850er-Jahren waren bereits mehrere der zwischen 1821 und 1840 geborenen Söhne von Josef Karl B.-Meyer und Nikolaus B.-Benziger I ins Geschäft eingetreten und in leitenden Positionen am Geschäftsausbau beteiligt.
Etwa von den 1860er-Jahren bis ins ausgehende 19. Jahrhundert gelang es der Firma Benziger, sich an der internationalen Spitze nicht nur innerhalb des katholischen Verlagswesens, sondern überhaupt des grafischen Gewerbes zu etablieren. Zum Vorteil gereichten der Firma Benziger dabei ihre Gründungen in den USA, die bis Ende der 1860er-Jahre beinahe konkurrenzlos blieben und ein lukratives Geschäft waren. In Kriegszeiten, etwa während des amerikanischen Bürgerkriegs von 1861 bis 1865 oder während des Deutsch-Französischen Kriegs 1870/71, und in sonstigen Phasen mit stockendem Absatz konnten sich die Geschäfte gegenseitig unterstützen und Krisenerscheinungen etwas abmildern. Im Sommer 1875 beispielsweise schrieb die Verlagsleitung in die USA: «Europa leidet durch den Culturkampf, Klosteraufhebung, Verbot religiöser Schulprämien in Oesterreich, allgemeine Handelskrise etc. Ihre Unterstützung in Arbeit und Geld wird nöthig werden.» 161
In den Quellen immer wieder genannt wird ein Argument, das bisher noch nicht angesprochen wurde: die positiven Auswirkungen der lokalen Konkurrenzgeschäfte auf die Entwicklung der eigenen Firma. In einem Brief, den die Verlagsleitung im Januar 1869 in die USA schrieb, heisst es: «Die Väter haben nie lebhafter das Geschäft entwickelt als von 1838 [gemeint ist wahrscheinlich 1830] bis 1846 wo das mächtige Kloster zu deren Ruin die Curigersche Conkurrenz geschaffen haben. Die Söhne sind nie so strebsam […] gewesen wie von 1857 bis jetzt wo eine u. zwei unliebe Conkurrentschaften entstanden. […] In angenehmem Zustande des Monopols […] wären wir heute vielfach im Geschäfte nicht so weit entwickelt. […] ausgedehnt haben unser Geschäft die Conkurrenzen.» 162
Unliebsame Konkurrenz – Einsiedeln als Verlags- und Druckereizentrum
Die Firma Benziger war zwar das bedeutendste, im 19. Jahrhundert aber zu keiner Zeit das einzige Unternehmen seiner Art in Einsiedeln. 1833 bestanden in Einsiedeln nicht weniger als fünf weitere Druckereiunternehmen. 163Ein für die Firma Benziger besonders ernst zu nehmender Konkurrent war das Kloster Einsiedeln, das sich mit dem Verlust der alten Vorrechte nur schwer abfinden konnte. Es unternahm verschiedentlich Versuche, seinen wirtschaftlichen Einfluss aufs Dorf zurückzuerhalten. Besondere Beachtung schenkte das Kloster dem Buchdruck. Eine Motivation dafür, wieder eine eigene Druckerei zu betreiben, war auch das Bestreben, der «schlechten» liberalen Presse mit eigenen «guten» Druckerzeugnissen begegnen zu können. Bereits im Jahr 1826 hatten konkrete Pläne bestanden, in Muri zusammen mit dem dortigen Benediktinerkloster eine eigene Buchdruckerei einzurichten. 1641829 übernahm das Kloster die Druckerei von Plazid Karl und Marianus Benziger. Als Mittelsmann figurierte der ehemalige Lehrer Thomas Kälin, mit dem das Kloster im Januar 1830 einen Vertrag schloss. 1651834 ging die Firma an die konservativ gesinnten Konrad Kuriger und Meinrad Kälin über, die sie, weiterhin unterstützt vom Kloster, unter dem Namen Kuriger & Co. weiterführten.
Читать дальше