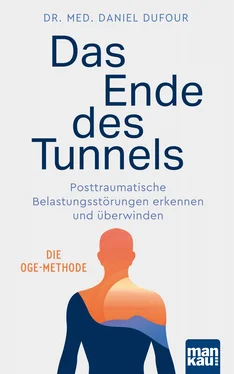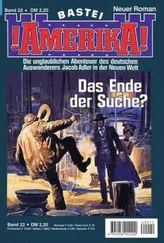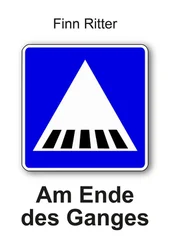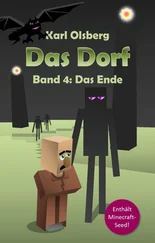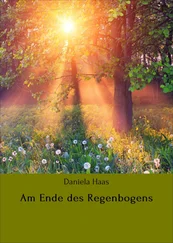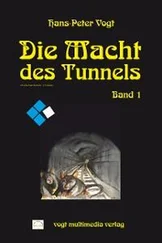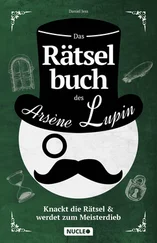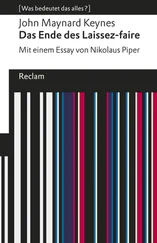Bei unserem nächsten Termin vertraut Pierre mir an, dass er seit dem Alter von sechs Jahren unter Klaustrophobie leide. Das Ganze fing nach einem Erdbeben in seinem Heimatdorf an. Er war damals einen Tag und eine Nacht in den Trümmern seines Zimmers eingeschlossen gewesen, das halb eingestürzt und voller Schutt gewesen war. Gegen Ende hatte er Mühe gehabt zu atmen, aber er konnte rechtzeitig gerettet werden. Sein Bruder, der im Nachbarzimmer eingeschlossen gewesen war, hatte nicht so viel Glück gehabt. Er war gestorben, genau wie sein Onkel väterlicherseits.
Seitdem hat Pierre dauerhaft Schuldgefühle, weil er überlebt hat, während sein Bruder gestorben ist. Er erträgt es nicht, in einem geschlossenen Raum eingesperrt zu sein. Er kann zwar Auto fahren, aber nicht in einem Flugzeug oder einem Zug reisen. Das beeinträchtigt ihn deutlich in seinem Privatleben, und manchmal auch im Berufsleben. „Ich hab mich halt damit abgefunden“, sagt er. Er kann in einer eigenen Wohnung leben, hat aber nicht geheiratet und ist Single. Das Schuldbewusstsein und die durchlebten Emotionen hat er für sich behalten und nie Hilfe gesucht. Zum einen hat er dazu keine Zeit, zum anderen denkt er, dass man ohnehin nichts machen kann.
Die Klaustrophobie und die Kreuzschmerzen, die Pierre so einschränken, sind lediglich Symptome und Folgen. In Wahrheit leidet Pierre an einer PTBS.
Fanny, 22, Krankenschwester
Bei einer feuchtfröhlichen Feier flirtet Fanny mit einem Mann, der sie anschließend mit zu sich nimmt. Sie weigert sich, mit ihm zu schlafen, er aber zwingt sie. Den Geschlechtsakt erlebt sie wie losgelöst, als ob ihr Körper nicht zu ihr gehöre.
Die Ereignisse liegen jetzt sechs Monate zurück. Seither durchlebt Fanny immer wieder Szenen aus ihrer Kindheit, in denen ihr betrunkener Vater nachts in ihr Zimmer kommt, um sie unsittlich zu berühren. „Ich hatte all das verdrängt, aber jetzt habe ich immer Albträume und schrecke aus dem Schlaf hoch.“
Seit dem Abend mit ihrem Vergewaltiger versetzt die Vorstellung, mit einem Mann intim zu werden, sie in Panik und widert sie an, obwohl sie bis dahin keinerlei Probleme mit ihrem Liebesleben gehabt hatte. Sie erträgt den alkoholgeschwängerten Atem anderer nicht mehr. Das löst bei ihr „eigenartige Gefühle“ aus, als sähe sie sich selbst „von außen, deformiert und total leblos“. In solchen Augenblicken hat sie Schweißausbrüche, zittert und durchleidet schreckliche Angst. Sie verfällt in Panik, weil sie nicht versteht, warum die Erlebnisse mit ihrem Vater wieder an die Oberfläche drängen: Sie hat ihm vor zwei Jahren verziehen, als er im Sterben lag. Schon seit zehn Jahren hatte sie nicht mehr daran gedacht.
Fanny hat eilig einen Psychiater aufgesucht, und bei ihr wurde eine psychotische Persönlichkeit diagnostiziert. Gleichzeitig wurde ihr ein Medikament verschrieben. Sie ist völlig aufgelöst und spürt intuitiv, dass sie an etwas anderem leidet und dass die Medikamente und die angeordnete Therapie nicht das Richtige sind.
Trotz der Diagnose des Psychiaters ist Fanny nicht psychotisch. Sie leidet an einer PTBS.
Marie, 52, Reinigungskraft
Vor zwei Jahren wurde Marie beim Überqueren der Straße vor ihrem Haus von einem Auto angefahren. Dabei brach sie sich den rechten Oberschenkel und musste sich eine Metallplatte einsetzen lassen. Die Operation verlief ohne Komplikationen, und sie geht seit achtzehn Monaten wieder ganz normal.
Seit Verlassen des Krankenhauses verfällt Marie jedes Mal in Panik, wenn sie aus dem Haus geht oder zurückkommt. Das Gefühl verfliegt, sobald sie den Hausflur betritt oder sich vom Haus entfernt. Sie hat wiederkehrende Albträume, in denen sie das Auto sieht, das sie angefahren hat. Die Erinnerungen werden mit der Zeit auch nicht schwächer, ganz im Gegenteil. Sie ist deprimiert, hat jede Spontaneität verloren und möchte manchmal einfach nicht mehr leben, obwohl die Geburt eines Enkels sie auch sehr glücklich macht. Sie versteht sich gut mit ihrem Mann, doch ihre Libido ist erloschen. Sie bricht häufig in Tränen aus, und ihre Nerven liegen blank, was für die Menschen um sie herum mehr und mehr zur Belastung wird. Der Arzt, den sie aufgesucht hat, hat ihr erklärt, dass sie allmählich in die Wechseljahre komme und deshalb diese Symptome habe. Depressionen seien häufig Teil dieser Phase. Er hat ihr ein leichtes Antidepressivum verschrieben, das sie seit sechs Monaten gewissenhaft einnimmt, das aber nicht zu wirken scheint.
Die anstehenden Wechseljahre haben nichts mit den depressiven Symptomen zu tun, die Marie bedrücken. Sie leidet vielmehr an einer PTBS.
Paul, 38, Polizist
Paul ist seit achtzehn Jahren Polizist. Er sucht mich auf, weil er laut Diagnose seines Kardiologen an Bluthochdruck leidet. Paul möchte keine Medikamente einnehmen, weil er findet, dass er dafür zu jung ist. Er fragt mich, ob es nicht eine andere Lösung gibt. Vor drei Jahren wurde bei ihm ein Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich operiert. Ansonsten sei er bei ausgezeichneter Gesundheit, befindet er: Er macht regelmäßig Sport, um körperlich fit zu bleiben, was in seinem Beruf sehr wichtig ist. Er achtet auf seine Ernährung und kennt keine Abhängigkeiten. Seit sieben Jahren ist Paul liiert, und einmal abgesehen von einigen Seitensprüngen sei die Beziehung stabil, „auch wenn es natürlich nicht mehr die große Verliebtheit der Anfangszeit ist“. Seine fünfjährige Tochter hat eine ernsthafte Erkrankung, für deren Behandlung sie jeden Monat eine Woche ins Krankenhaus muss. Als ich ihn frage, was er angesichts all dessen empfindet, ist seine Antwort folgende: „Wissen Sie, bei all dem, was ich in meinem Beruf erlebe, habe ich mir angewöhnt, nicht so viel zu empfinden, ich nehm das so hin.“ Dieser Satz, den er so kühl und distanziert von sich gibt, macht mich stutzig.
Paul liebt seinen Beruf, auch wenn es „manchmal schwierig ist. Aber je weiter man kommt und je mehr Erfahrung man hat, desto besser erträgt man es.“ Ich frage ihn, was er nach solch schwierigen Momenten macht, und er sagt mir, er gehe laufen, weil er sich dabei abreagieren könne. Sowieso müsse er unbedingt regelmäßig laufen gehen, sonst sei er zu nervös und raste „zu Hause völlig aus“. Befördert werden möchte er auch nicht, denn: „Dazu müsste ich den politischen Hickhack mitmachen oder die ganze Vetternwirtschaft, und das ist nicht mein Ding.“ Er wartet auf die Rente, die er in zwölf bis fünfzehn Jahren beantragen könne.
Ich frage ihn, ob es denn vorkomme, dass er an die schwierigen Situationen zurückdenkt, die er durchlebt hat. Er sagt mir, dass er manchmal Albträume habe im Zusammenhang mit einem Vorfall vor einigen Jahren, bei dem ein Mann, der im Auto eingeklemmt gewesen war, vor seinen Augen verstorben ist. Auch andere Erlebnisse gehen ihm von Zeit zu Zeit durch den Kopf. Er versteht nicht recht, warum genau diese und nicht andere, aber er vertreibt sie sofort, „um nicht mehr daran denken zu müssen“. Nach gewissen beruflichen Einsätzen fallen ihm auch manchmal vergleichbare Szenen ein. Dann wird er nervös, schwitzt stark und muss einen Moment lang pausieren, bevor er weiterarbeiten kann. Diese Vorfälle dauern bis zu einer halben Stunde. Sie hinterlassen bei ihm das seltsame Gefühl, sich selbst zuzusehen: „als schwebte ich über den Dingen und wäre mein eigener Zuschauer“.
Spricht Paul mit jemandem in seinem Umfeld darüber? „Ja, ich habe mit einem Kollegen darüber gesprochen, mit dem ich eng befreundet bin, und das hat mich beruhigt, weil er gesagt hat, dass ihm das auch passiert.“ Er schiebt es auf den Stress bei der Arbeit, die Müdigkeit und die Tatsache, dass es ihm manchmal eben nicht so gut gehe und er dann nicht so widerstandsfähig sei. Sieht er einen Zusammenhang mit den körperlichen Problemen, die er hat? „Vielleicht gibt es einen Zusammenhang, aber ehrlich gesagt wüsste ich nicht, welchen.“
Читать дальше