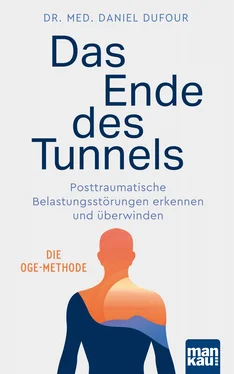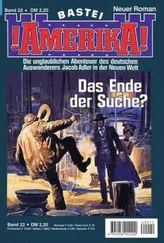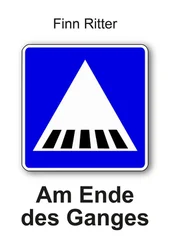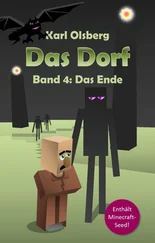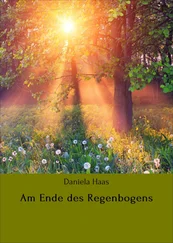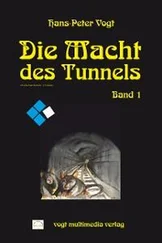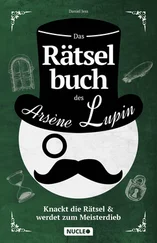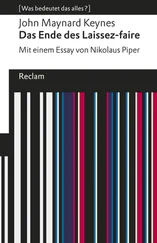Die Symptome der Betroffenen sind schon lange bekannt und können einzeln mehr oder weniger wirksam behandelt werden. Im Fall einer traumatisierten Person, welche all diese Symptome zeigt, erweisen sich diese Behandlungsmethoden jedoch als unwirksam. Dann kann es zu Teildiagnosen kommen, weil man sich auf einzelne statt auf alle Symptome stützt, oder schlimmer noch zu Fehldiagnosen. Diese ziehen dann Behandlungen nach sich, die entweder völlig ungeeignet sind oder nur auf die Linderung eines einzelnen Symptoms abzielen. Diese Behandlungen gehen oft an der wahren Ursache der Leiden vorbei: dem schmerzlichen Erlebnis des Traumas.
Einen weiteren Punkt gilt es hervorzuheben: Eine PTBS tritt häufig bei Menschen auf, die sogenannte Risikoberufe ausüben, also bei Soldaten, Polizisten, Gefängniswärtern, Feuerwehrleuten, Notärzten, Rettungssanitätern, Lokführern, Mitarbeitern von Hilfsorganisationen, Sozialarbeitern, Menschen also, die üble Geschichten erleben oder zu hören bekommen. Aber auch Richter, Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Gerichtsschreiber und viele andere sind davon betroffen. Diese Tatsache wird immer noch viel zu häufig kleingeredet, hauptsächlich natürlich von den Vorgesetzten und dem System selbst, aber auch von den Betroffenen.
Meist begnügt man sich damit anzuerkennen, dass die PTBS existiert, um dann festzustellen, dass sie statistisch gesehen selten ist. Und Angestellten, die sich darauf berufen wollen, stellt man natürlich diverse Hilfsangebote und Krisengespräche in Aussicht. Auch wenn manche Führungskräfte sehr wohl das Ausmaß des Problems und der daraus resultierenden Kosten für die Allgemeinheit erkennen, scheint man in den oberen Etagen die Konsequenzen nicht hinnehmen zu wollen. Diese sind Öffentlichkeitsarbeit und Prävention oder auch die Unterstützung betroffener Angestellter, damit sie von den Beschwerden geheilt werden können, die durch traumatische Ereignisse im Rahmen ihrer Arbeit ausgelöst wurden. In solchen beruflichen Milieus herrscht oft das Gesetz des Schweigens. Es trägt in hohem Maße dazu bei, dass die PTBS auch weiterhin belastend bleibt.
Jetzt ist die Zeit gekommen, klar aufzuzeigen, was mit einer PTBS gemeint ist, Anzeichen derselben sowie die Therapien zu beschreiben, die derzeit verfügbar sind, wobei auch ihre Wirksamkeit zu beurteilen ist.
Vor allem aber soll eine Behandlungsmethode vorgestellt werden, die sich seit dreißig Jahren bewährt hat. Sie ist aus dem selbst Erlebten hervorgegangen, denn ich habe alles getan, um von dieser Störung geheilt zu werden, statt nur irgendwie weiterzumachen und mich mit ihr zu arrangieren.
Auf den folgenden Seiten werde ich gelegentlich Kommentare einstreuen, die auf meinen persönlichen Erfahrungen beruhen, aber auch auf den Erfahrungen, die ich mit allen Patienten machen konnte, die ich in den letzten dreißig Jahren begleitet habe.
Erster Teil
Die PTBS
als Krankheit

Kapitel 1
Wer kann von einer PTBS betroffen sein?

Auf den folgenden Seiten stelle ich verschiedene Fälle vor. Es handelt sich um Patienten, die ich im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit getroffen habe. Sie zeigen, dass ein Trauma plötzlich und recht brutal im Alltag entstehen kann, und dass die Verbindung zwischen demselben und dem Leidensdruck allzu oft leider nicht hergestellt wird. Die Folge sind Fehldiagnosen und ungeeignete oder nutzlose Behandlungen. Ich verzichte absichtlich auf das Beispiel eines Soldaten, der an einer PTBS leidet, denn mein Ziel ist es zu zeigen, dass nicht nur Soldaten von Traumata betroffen sein können.
Nicole, 24, Einzelhandelskauffrau
Nicole sucht mich auf, weil sie schon immer „ein echter Hasenfuß“ war. Man hat bei ihr eine schwere Angststörung und daraus folgende Aufmerksamkeitsdefizite diagnostiziert. Seit vier Jahren ist sie bei einem Psychiater und einer Psychologin in Behandlung. Sie findet aber, dass es nicht schnell genug vorangeht. Außerdem möchte sie die Angstlöser nicht weiter einnehmen, die sie seit sechs Jahren täglich schluckt. Ich frage sie, was vor sechs Jahren passiert ist, damit ihr ein Arzt solche Medikamente verschreibt. Sie antwortet mir, sie habe zu dieser Zeit eine Beziehung mit einem zwei Jahre älteren Mann geführt, der verbal übergriffig gewesen sei. Sie hatte Angst, „dass das schlimmer wird“, und beendete die Beziehung eilig. Seither hat Nicole fast monatlich eine Blasenentzündung. Trotz allerlei Untersuchungen vonseiten ihres Arztes ist die Ursache dafür immer noch unbekannt. Anzumerken ist, dass sie schon seit der Kindheit wiederholt Blasenentzündungen hatte. Als Kind litt sie auch häufig an Mittelohrentzündungen, was die Einnahme von Antibiotika erforderlich machte. Seit dem achten Lebensjahr hatte sie jedoch keine mehr.
Nicole liebt ihren Beruf, auch wenn sie nicht vorhat, ihn ein Leben lang auszuüben. Sie hat „solche Angst davor, in einer neuen Umgebung zu arbeiten, dass sie sich im Moment nicht vorstellen kann zu wechseln“. Sie macht eine kognitive Verhaltenstherapie, um ihre Angst in den Griff zu bekommen, was ihr im Alltag auch hilft. Doch durch jede Abweichung von der Routine verliert sie die Fassung: Sie fühlt sich dann wie gelähmt und zieht sich sofort zurück, damit die anderen nicht mitbekommen, was für eine Angst sie hat. Sie ist sich ihres Kontrollzwangs bewusst, genau wie der Tatsache, dass sie keine Improvisation erträgt. Das macht natürlich jede Spontaneität zunichte. Sie hat den Eindruck, das Leben zu verpassen, erkennt aber, „dass das im Moment immer noch besser ist als alles, was sie bis dahin durchgemacht hat“. Sie möchte die Medikamente auch nicht für immer nehmen.
Seit der Beziehung, die Nicole vor sechs Jahren beendet hat, weigert sie sich, eine neue einzugehen. Sie denkt ziemlich oft an die damals erlittene verbale Gewalt. Manchmal träumt sie sogar davon. Es ist ihr sogar passiert, dass sie sich bei Filmszenen, die sie an ihre Erlebnisse erinnern, so schlecht fühlte, dass sie den Fernseher ausschalten oder das Kino verlassen musste. Seitdem geht sie nicht mehr ins Kino und achtet genau auf den Inhalt der Filme, die sie im Fernsehen anschauen möchte: Es darf keine Gewalt darin vorkommen. Von Zeit zu Zeit hat sie Geschlechtsverkehr mit Männern, die sie anschließend aber nicht wiedersehen möchte. Laut eigener Aussage ist sie mit ihrem Sexualleben zufrieden, und es gab weder eine Vergewaltigung noch andere Übergriffe in der Vergangenheit.
Bei ihren nächsten Besuchen erzählt Nicole mir, dass sie nach der Scheidung ihrer Eltern, als sie vier war, bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater gelebt hat. Letzteren hasste sie, weil er zu verbaler Gewalt neigte und sie sehr oft bestrafte, indem er sie in ihrem Zimmer einschloss. Diese Strafen konnten mehrere Stunden dauern, einmal war sie sogar zwei ganze Tage eingesperrt. Anfangs brüllte sie in ihrem Zimmer, lernte dann aber, sich ruhig zu verhalten, da ihr Gebrüll die Bestrafung um mehrere Stunden verlängerte. Brachte man ihr in dieser Zeit etwas zu essen, hatte sie ihrem Stiefvater oder ihrer Mutter zu danken.
Mittelohr- und Blasenentzündungen sowie die Angstzustände sind nur die Folge der Störung, an der Nicole seit ihrer Kindheit leidet. Nicole hat eine PTBS.
Pierre, 37, Maurer
Pierre kommt in meine Sprechstunde, weil er seit zwei Jahren starke Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule hat. Das schränkt ihn in seiner Arbeit sehr ein. Er ist selbstständig und mag, was er tut. Nach einer viermonatigen Unterbrechung will er wieder arbeiten, doch die Schmerzen sind immer noch da, obwohl er Physiotherapie gemacht und einen Osteopathen aufgesucht hat. Alle denkbaren Untersuchungen sind veranlasst worden. Es liegen weder Verletzungen noch ein Bandscheibenvorfall vor. Die Schmerzen sind aufgetaucht, nachdem Pierre in einer Villa gearbeitet hat, in der er neue Innenwände hatte einziehen sollen. „Diese Baustelle war schlimm für mich, weil ich mich die ganze Zeit eingeschlossen fühlte und den Eindruck hatte zu ersticken“, sagt er mir.
Читать дальше