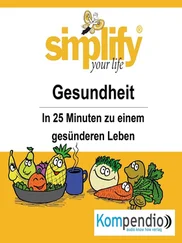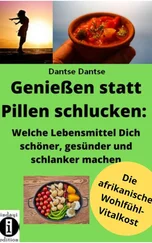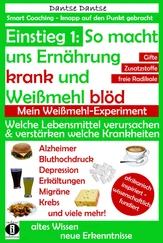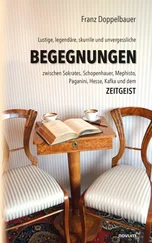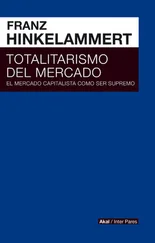3.4. „Wir sind die Ausgespuckten.“ Erinnern und Vergessen in der Bibel
4. Demenz – die „Theological Disease“
5. Gedächtnis als Schlüsselkategorie der liturgischen Feier
5.1. Liturgische Anamnese und die Gegenwärtigkeit der Lebensform Demenz
5.2. Caritas und Liturgie: Menschen mit Demenz im Mittelpunkt
II. Menschen mit Demenz feiern Gottesdienst im Pflegeheim
1. Das Pflegeheim als Ort der Versammlung christlicher Gemeinden
1.1. Das Pflegeheim: ‚Insel der Seligen‘ oder ‚Ort der Not‘?
1.2. Wo Gottesdienst feiern? Kapelle, Aufenthaltsraum, Speisesaal?
1.3. Wie kommen die Menschen zum Gottesdienst oder der Gottesdienst zu den Menschen?
2. Was ist ein Gottesdienst im Pflegeheim?
2.1. Vertrautes und Neues
2.2. Formen gottesdienstlicher Feiern im Pflegeheim
2.3. Taizé-Andacht für Menschen mit fortgeschrittener Demenz
2.4. ‚Spirituelles Singen‘ im CS Pflege- und Sozialzentrum Kalksburg
3. Das Volk Gottes im Pflegeheim
3.1. Die feiernde Gemeinde
3.1.1. Menschen in verschiedenen Phasen des Demenz-Prozesses im Gottesdienst
3.1.1.1 Unterschiedliche Bedürfnisse
3.1.1.2. Störungen als Signale
3.1.1.3. Gemeinsames Feiern oder eigene Gottesdienste für Menschen mit fortgeschrittener Demenz?
3.1.2. Die Rolle der ‚gesunden‘ Mitfeiernden im Gottesdienst für Menschen mit Demenz
3.1.3. ‚Anwesenheit‘ von Abwesenden
3.2. Leitungsamt und liturgische Dienste
3.3. Momente des Kontakts: Die Leiterin/der Leiter des Gottesdienstes und die Menschen mit Demenz
3.4. Liturgie im Pflegeheim als Frauen-Liturgie?
3.5. Evangelische und katholische Christinnen und Christen im PflegeheimGottesdienst
4. Musik, Symbol, Sprache: Wege zum Menschen und Wege zu Gott
4.1. Einschränkungen – Herausforderungen – Chancen
4.2. Musik
4.3. „Mit allen Sinnen“: offen sein für das Geheimnis
4.3.1. „Mit allen Sinnen“
4.3.2. Möglichkeiten und Grenzen von Symbolen
4.3.3. „Die schwächer scheinenden Glieder des Leibes“ (1 Kor 12,22) – Sakrament und Demenz
4.4. „Die wankende Brücke der Sprache“: Sprache und Sprachlosigkeit
4.4.1. Verbale und nonverbale Sprache
4.4.1.1. Demenz und Sprache
4.4.1.2. Verbale, nonverbale und paraverbale Kommunikation
4.4.2. Liturgische Sprache und Menschen mit Demenz
4.4.2.1. Schriftverkündigung und Predigt
4.4.2.1.1. Die Bibel im Gottesdienst mit Menschen mit Demenz
4.4.2.1.2. Die Predigt im Gottesdienst mit Menschen mit Demenz
4.2.2.2. Gebete und Lieder
III. Von der Zweckfreiheit des Gottesdienstes
1. MAKS: Spirituelle Runden als Teil einer Aktivierungstherapie für Menschen mit Demenz
2. Spiritualität und Demenz, Gesundheit und Wohlergehen: Auf der Suche nach Zusammenhängen
3. Macht Religion gesund?
4. ‚Heilung‘ und Gottesdienst im Pflegeheim
5. Beobachtete Wirkungen von gottesdienstlichen Feiern
6. „Liturgie ist kein Mittel, das angewandt wird, um eine bestimmte Wirkung zu erreichen.“ (Romano Guardini)
7. Gratuität des Gottesdienstes im Verständnis von Taizé
IV. Schlussbemerkungen und Ausblick
Bibliographie
Anhang:Der Anhang, auf den im Text laufend verwiesen wird, ist nicht Teil dieses Buches. Er ist im Internet abrufbar unter http://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/308647(Seitenzahlen I – CCXXXIV)
Einleitung
Am 11.5.2013 besuchte ich im Wiener Burgtheater eine Vorstellung der Wiener Festwochen: In Romeo Castelluccis Performance Sul concetto di volto nel Figlio di Dio (Über das Konzept des Angesichts von Gottes Sohn) geschieht nichts anderes, als dass ein mit Anzug und Krawatte für den Weg zur Arbeit gekleideter Mann versucht, seinem an Demenz leidenden Vater die Windel zu wechseln. Die Situation eskaliert immer mehr. Am Ende ist die ganz in weiß gehaltene Wohnlandschaft voller Kot und beide Männer, der eine nackt, der andere mit beschmierter Business-Kleidung, vollkommen verzweifelt. Diese Szene tiefster Entwürdigung und Verzweiflung stellt Castellucci vor die Reproduktion eines die ganze Bühne überragenden, wunderschönen Jesusgesichts des Renaissancemalers Antonello da Messina. Zum Schluss kommen Kinder auf die Bühne und bewerfen Jesusgesicht mit Handgranaten. In diesem Augenblick begann direkt neben uns ein Pfeifkonzert und laute Rufe, ohrenbetäubend gemeinsam mit dem Lärm der Handgranaten: „So eine Schweinerei!“, „Das ist keine Kunst!“. Ein Freund, der mit mir die Vorstellung besuchte, war überzeugt, auch dieser Protest wäre Teil der Inszenierung. Er diskutierte mit den jungen Leuten und musste einsehen, dass es wirklich eine Gruppe von jungen Katholikinnen und Katholiken war, die ihrer Empörung Ausdruck verliehen. Unter ihrem lautem Protest endete das Stück damit, dass hinter dem zu diesem Zeitpunkt zerstörten Gesicht Jesu ein Satz lesbar wurde, der abwechselnd zu lesen war als: „You are my shepherd.“ und „You are not my shepherd.“
Nach der Vorstellung sprachen wir vor dem Theater noch eine Weile mit den Jugendlichen: Was motiviert Christinnen und Christen gegen dieses Stück zu protestieren. Handgranaten auf das Gesicht Christi? Ja, das wohl auch. Im Gespräch wurde aber doch deutlich, dass es vor allem darum ging, dass menschliches Elend so schonungslos vorgeführt wird. Menschen, die ein Kreuz um den Hals tragen, wollen einen nackten alten Mann voll Kot auf der Bühne nicht sehen. Und doch provoziert christlicher Glaube bis heute genau damit: „Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten: für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit“, so Paulus im 1. Korinther-Brief (1,23). Das Stück Sul concetto di volto nel Figlio di Dio provoziert auch mich mit der Frage: Hältst du es aus? Bleibst du da? In welchem Antlitz erkennst du das Gesicht des Sohnes Gottes?
Ich schreibe dieses Buch als Seelsorger in einem Pflegeheim. Szenen wie die von Castellucci dargestellte sind Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, nicht fremd. Lotte Hochrieder habe ich Ende 2012 kennengelernt, nachdem sie ins Pflege- und Sozialzentrum Rennweg eingezogen war. Zu diesem Zeitpunkt lebte sie schon in einem fortgeschrittenen Stadium von Alzheimer-Demenz. 2005 wurde sie noch zur stellvertretenden Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates ihrer Pfarrgemeinde gewählt. Damals hat sie im Pfarrblatt geschrieben:
„So bin ich im Laufe der Jahre in das Pfarrleben hineingewachsen und habe verschiedene Aufgaben und Verantwortung übernommen. In Zeiten, wo es mir nicht gut ging, habe ich Halt in der Pfarrgemeinschaft gefunden. Das Vertrauen der Asperner freut mich, da sie mich bereits zum zweiten Mal als Stellvertretende Vorsitzende des PGR gewählt haben. […] Eines ist mir wieder ganz klar geworden. Gott geht mit mir Wege, die ich nicht vorausplane. Doch entscheidend ist, diese Wege mitzugehen wie ein Kind, das seinem Vater die Hand reicht zum Mitgehen. Zuerst innerlich ein wenig widerspenstig, aber dann doch voll Vertrauen. Er ist ja mein Vater und er hat mich unendlich gern. Was ich mir wünsche, ist eine große Bereitschaft für dieses ‚Leben in Fülle‘, das Gott mir – uns – immer wieder anbietet.“ 2
Zwei Jahre nach Ende der Pfarrgemeinderatsperiode, für die sie gewählt wurde, kann Lotte Hochrieder solche Gedanken nicht mehr formulieren. Sie kann kaum noch sprechen und geht unermüdlich den Gang des Wohnbereiches, in dem sie ihr Zimmer hat, auf und ab. Den Weg durch diese Jahre zu gehen, „an der Hand des Vaters“, muss sehr schwer gewesen sein und ist es bis heute, besonders für die Menschen, die Lotte Hochrieder nahestehen. Wie kann man ihre Worte von damals heute verstehen? Dem Beobachter könnten zynische Gedanken kommen über den Vater, der seinen geliebten Kindern diese Art von „Leben in Fülle“ beschert.
Читать дальше