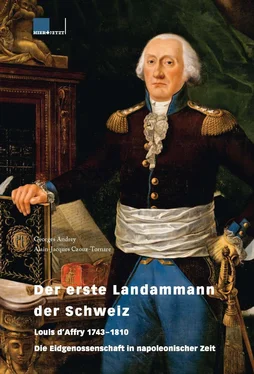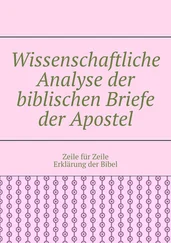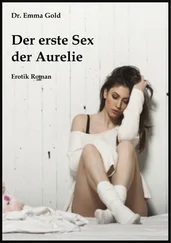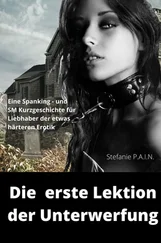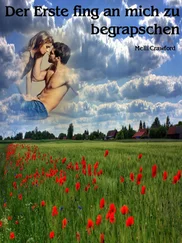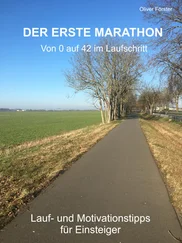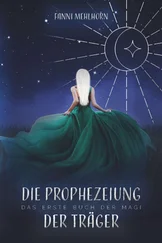1 ...6 7 8 10 11 12 ...27 Unter den Besuchern, welche diese ganz neue Art von Handelsmessen neugierig verfolgten, fanden sich hauptsächlich Berner, aber auch Schweizer aus anderen Kantonen sowie ausländische Touristen. Der Wahrheit zuliebe muss man sagen: 1804 und 1810 waren Jahre ohne Kriegswirren, was den Besuch von zahlreichen Engländern erlaubte. Für sie gebrauchte man zum ersten Mal das Wort «Tourist», welches seit 1803 bescheinigt ist. Die schroffe Bodengestaltung und die Höhe der Berge, die sommerliche Sonne und der ewige Schnee zogen diese Besucher an, welche aus dem nebligen und ebenen England anreisten. Sie kamen nicht wegen des Komforts der Hotellerie, die noch in den Anfängen steckte, sondern eher, um von zu Hause wegzugehen und das Schauspiel der rohen, aber als natürlich angesehenen Bräuche der Bergler zu besichtigen, etwa die der Hirten am Unspunnenfest im Berner Oberland 1808. Bisweilen gaben sich diese im Allgemeinen begüterten Gäste, «gentlemen’s farmer», reiche Industrielle oder wohlhabende Bankiers amüsiert-distanziert, mit einem herablassenden Blick. Einige der Waghalsigeren schwärmten für den Sport und den Alpinismus, zwei noch unbekannte Ausdrücke. Die Nichtexistenz von Wörtern verhinderte jedoch die Sache nicht: Engländer, Franzosen, Deutsche und Schweizer – diese Letzteren machten den «Alpenstock» zum Gemeingut des Wanderers – rivalisierten um die Besteigung der höchsten Gipfel. 1811 wurde die Jungfrau bezwungen oder geschändet, wenn man es so sehen will.
Wer würde es glauben, dass die Schweiz, die heute im Bereich der Privatversicherungen eine führende Position belegt, lange Zeit vom Ausland abhängig war, bevor sie ihre Ansprüche und ihr Wissen auf diesem Gebiet durchsetzen konnte? Die frühzeitige Industrialisierung hatte schon lange die grossen englischen, französischen und deutschen Gesellschaften angezogen. 66Sie zu konkurrenzieren war keine leichte Sache, denn sie waren auf europäischer Ebene mit ihrem grossen Kapital und ihrer Erfahrung schon stark verankert. Aber der initiative Unternehmungsgeist der Schweizer der Mediation brachte es fertig, sich auch in diesem Sektor ab dem 19. Jahrhundert und bis heute mit Erfolg durchzusetzen. Überraschenderweise versicherte man die Güter vor den Personen, dies vor der Mediation und noch lange Zeit danach. Die öffentliche Hand ging in dieser Domäne voran, und ein Dutzend Kantone gründeten zwischen 1805 und 1812 ihre eigene Versicherungskasse für Tiere und Feuer. Die Schweiz war noch ein Land mit bäuerlicher Vorherrschaft, und die meisten Häuser waren immer noch aus Holz gebaut, auch in der Stadt.
Was die Banken betrifft, gelang es den Schweizern, das Vertrauen sehr früh zu gewinnen, 67und ihr Erfolg im monarchischen Frankreich von Ludwig XIV. bis Ludwig XVI. ist hinlänglich bekannt. Anfang des 19. Jahrhunderts finanzierten sich in der Schweiz die industriellen Unternehmungen der Gründerzeit selber. Die grossen Handelsbanken ebenso wie die Kantonalbanken wurden erst relativ spät gegründet. Im Gegensatz dazu förderten die Behörden den Kleinkredit schon während der Mediation. So entwickelten sich die öffentlichen Sparkassen und die Lokalbanken, welche am Ende des 18. Jahrhunderts eher zögerlich aufgetreten waren. 68Eine Tatsache, die man hervorheben muss: Die Kunden der Sparkassen rekrutierten sich hauptsächlich aus den bescheidenen Schichten der Bevölkerung – Angestellte im Handel, Mägde, Knechte und vor allem die immer zahlreicher werdenden Arbeiter. Sie wurden dazu durch ihre Arbeitgeber ermuntert in einer Zeit, in der die soziale Vorsorge unter der Devise «Hilf dir selbst, so hilft dir Gott!» noch der Initiative des Einzelnen überlassen war.
MEHR ALS WIRTSCHAFT: DER MORALISCHE WIEDERAUFBAU DES LANDES
Der beste Teil des reichen Erbes, welches die Mediation der heutigen Schweiz vermacht hat, ist nicht politischer oder wirtschaftlicher Natur, sondern kulturell im weiten Sinn des Wortes, welches kollektive Mentalitäten und öffentliches Empfinden einschliesst. Die nachfolgende notgedrungen zu kurze Aufzählung beschränkt sich nur auf die bedeutendsten Errungenschaften.
Nach dem Erdbeben der Revolution von 1798 und nach dem Bürgerkrieg von 1802 erfolgte der Wiederaufbau des Landes nicht nur durch die Einführung eines neuen Föderalismus und durch die Wiederankurbelung der Wirtschaft, sondern es war nötig, sich wieder zusammenzufinden, denn die ganze Gesellschaft war traumatisiert und auf der Suche nach neuen Bezugspunkten und neuen Werten. Sie empfand das diffuse Bedürfnis, zu einem neuen Lebensstil zu finden. Die entscheidende Frage lautete: Wie kann man die Gesellschaft der Bürger (société civile) an der politischen und wirtschaftlichen Macht beteiligen? Die Antwort schien im Wesentlichen in vier Punkten zu liegen: Man wollte die nationale Identität fördern, die sozialen Ungleichheiten berücksichtigen, die Minderheiten anerkennen und den Zugang zum Wissen revolutionieren.
Hatte das Schweizer Volk unter dem Ancien Régime ein eidgenössisches Selbstbewusstsein? Offenbar nicht. Seine Verschiedenartigkeit verbarg seine Einheit. Nur die politische und intellektuelle Elite pflegte das, was man heute «Idée suisse» nennt, Ausdruck einer spezifischen Identität, die als national in dem Mass qualifiziert werden kann, wie die «Schweizer Nation» ein Bestandteil des politischen und literarischen Vokabulars war. Die neue sozial abgestützte Umgangsform des Aufklärungszeitalters hatte die «Helvetische Gesellschaft» 69hervorgebracht, die dazu bestimmt war, die kultivierten Schweizer einander näherzubringen, um das Vaterland miteinander zu feiern, seine Geschichte und seine Helden; allen voran Wilhelm Tell, an dessen Existenz damals niemand zweifelte. Seine Popularität als Held, der sein Land liebt und seine Familie verteidigt, seine Geschichte, die absolut glaubwürdig klingt und die mit dem Begriff von Freiheit und Unabhängigkeit verbunden ist, halfen den damals noch hauptsächlich ländlichen Massen, den abstrakten Begriffen von schweizerischem Vaterland und patriotischen Bürgern einen Inhalt zu geben. Unter der Helvetik, und das war ihr Drama, wurde der vaterlandsliebende Tell von Anhängern und Gegnern der Revolution, die sich um ihn stritten, vereinnahmt. In der Mediation, und das war ihre Chance, versöhnte Tell das Land: «Keine Ketten den Kindern Tells!», erklärte der Mediator Napoleon, der einen politisch-medialen Volltreffer landete, indem er sich gewandt die Popularität des nicht weniger gewandten Schützen zunutze machte. Es ist kaum zu glauben, dass Uri, das Vaterland des Armbrustschützen, 1803 in Bonaparte den Wilhelm Tell der modernen Zeiten feierte! Fast zur gleichen Zeit bemächtigte sich Schiller 1804 in Deutschland des bekanntesten Schweizers, um aus ihm einen universalen Helden zu machen. 1805 gab es in Sarnen ein «Fest der nationalen Einheit», welches die Gelegenheit nutzte, ein grosses historisches und patriotisches Schauspiel in vier Akten aufzuführen, worin das ganze mittelalterliche Pantheon mit Tell und Winkelried als Stars 70vorkam. Um 1807 erwachte die Helvetische Gesellschaft, die seit 1798 dahindämmerte, wieder zum Leben.
Die helvetische Identität war offensichtlich ein Wert, nutzbar und ausgebeutet für die verschiedensten Ziele. 1808 wurde in Luzern die «Helvetische Gesellschaft für Musik» gegründet. 71Dieser Akt hatte eine hohe symbolische Bedeutung für das Band zwischen der Classe politique und den Bürgern. Gerade in diesem Jahr empfing Luzern als Vorort die eidgenössische Tagsatzung. Als Hauptstadt der Schweiz für ein Jahr wandte sich die Stadt an den damals bekanntesten Schweizer Musiker, den Zürcher Hans Georg Nägeli, ein avantgardistischer Herausgeber, der seit 1803 Beethoven publizierte (Sonate für Klavier, Opus 31, «Der Sturm») und der später mit Schubert und Weber in Verbindung stand. 72Nägeli, modern und phantasievoll, war nicht nur der Gründer der Helvetischen Gesellschaft der Musik, sondern auch während der Tagsatzung Organisator von helvetischen Konzerten, den symphonischen und choralen Feiern der nationalen Brüderlichkeit! Ein phänomenaler und dauerhafter Erfolg. Solche Konzerte und die Helvetische Gesellschaft trugen dazu bei, während des ganzen 19. Jahrhunderts in der Bevölkerung die Liebe zur Musik und die Freude am Musizieren zu verbreiten, gleichsam natürlich verbunden mit der Schweizer Identität.
Читать дальше