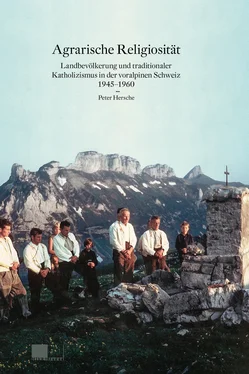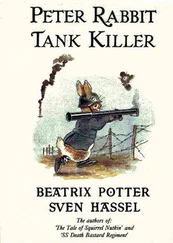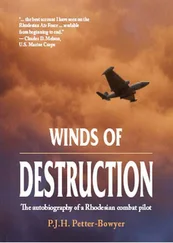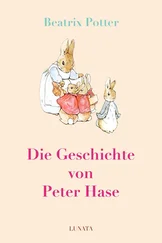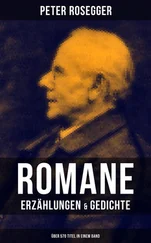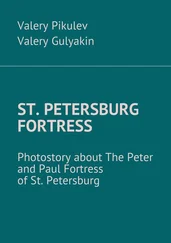Peter Hersche - Agrarische Religiosität
Здесь есть возможность читать онлайн «Peter Hersche - Agrarische Religiosität» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Agrarische Religiosität
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Agrarische Religiosität: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Agrarische Religiosität»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Agrarische Religiosität — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Agrarische Religiosität», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die tatsächliche Armut, also ein Zustand, wo eine Familie wirklich zeitweise Hunger litt und die Frauen kaum wussten, womit sie am nächsten Tag Brot kaufen oder den Kochtopf füllen sollten, wo die Kleidungsstücke vor allem Löcher hatten und die Kinder einen grossen Teil des Jahres barfuss gingen, die Wohnräume erbärmlich ausgestattet und im Winter eher kalt waren, wurde verschieden bewertet. Die Kinderzahl spielte bei solchen Zuständen zweifellos eine entscheidende Rolle. Aber dieses Thema war tabuisiert und wurde von den meisten als unabänderliches Schicksal hingenommen. Es gab Arme, deren Notlage man als selbstverschuldet betrachtete – etwa bei Trinkervätern und anderen unordentlichen Verhältnissen – und die deshalb wenig Erbarmen, sondern im Gegenteil Verachtung hervorriefen. Umgekehrt stiess unverschuldete Armut auf Mitleid und Hilfsbereitschaft in verschiedenen Formen. Solche Fälle waren infolge mangelnden Versicherungsschutzes vor allem für Personen damals nicht selten. 33Längere oder komplizierte Krankheiten sowie Unfälle mit nachfolgender teilweiser oder gänzlicher Arbeitsunfähigkeit konnten eine Familie an den Rand der Existenz bringen. Besonders schlimm war der Verlust eines Elternteils durch unerwarteten Tod. Wenn, aus welchen Gründen auch immer, keine Wiederverheiratung des überlebenden Ehepartners erfolgte, so wurden die Kinder, wenn nicht Verwandte oder die Paten sich ihrer annahmen, ins Waisenhaus gegeben. In Obwalden gab es mehrere davon. Im zentralen appenzellischen Waisenhaus «auf der Steig» waren 1948 noch rund 100 Kinder untergebracht. 34In diesen Häusern erhielten sie von Ordensschwestern eine strenge und oft lieblose Erziehung, besuchten aber im Übrigen die reguläre Dorfschule. Das im Mittelland früher übliche Verdingkindersystem kannte man dagegen in unserem Untersuchungsgebiet kaum. Männliche Waisen wurden allerdings häufig Bauernknechte.
Nachdem die wesentliche Ursache struktureller Armut, nämlich die hohe Kinderzahl, nicht hinterfragt werden konnte und durfte, waren die Kirche und ihre Repräsentanten ebenso wie die einfachen Gläubigen gefordert, die in der Bibel vorgezeichnete Karitas zu üben. Diese war im katholischen Raum sehr ausgebaut. Es gab neben der staatlichen und gemeindlichen Armenpflege und neutralen Organisationen (Winterhilfe usw.) auch kirchliche Institutionen, welche sich der Fürsorge der Armen widmeten. In Appenzell etwa half ihnen der Vincentiusverein mit Sach- und Geldspenden. So konnten sie zum Beispiel bei einem Bäcker einen Monat lag unentgeltlich Brot beziehen oder bekamen einen Sack Kartoffeln. 35Andere Vereine machten dort alljährlich Weihnachtsbescherungen für die Kinder armer Familien. In Obwalden existierten alte Spendstiftungen und das «Elisabethengeld» für Arme. 36Wie auch anderswo, gab es beiderorts in jeder katholischen Kirche einen speziellen, dem Antonius von Padua gewidmeten Opferstock. In diesen warf man vor allem Geld, wenn man einen Gegenstand verloren hatte und den mit Hilfe des Heiligen wieder zu finden hoffte. Die Erträgnisse gingen an die Armen. Ferner gab es sonntägliche Kirchenopfer zu deren Gunsten. Eine in der ganzen katholischen Welt bekannte und bis in die 1960er-Jahre noch viel benutzte Einrichtung war ferner die Klostersuppe. Es gab sie in den beiden Kapuzinerklöstern von Appenzell und Sarnen, ebenso in den beiden dort ansässigen Frauenklöstern sowie im Stift Engelberg. Die nicht allzu weit entfernt wohnenden Dorfarmen konnten sie dort mittags in einem besonderen Stübchen einnehmen oder sogar in einem Kesselchen nach Hause tragen 37und hatten damit wenigstens eine warme Mahlzeit im Tag. Es war ferner üblich, dass die Armen an die Türen der Pfarrhäuser klopften, um eine Gabe zu erbitten. Das Verhalten der geistlichen Herren dabei wird von den befragten Leuten unterschiedlich geschildert: Es gab neben zugeknöpften, ja geizigen, auch solche, die trotz ihrer damals nicht seltenen geringen Entlohnung sehr mildtätig waren, ja in Ausnahmefällen die Bettelleute sogar zu Tisch luden. 38Ein solches Verhalten konnte selbstverständlich von «Berufsbettlern» auch missbraucht werden und dann auf die Dauer lästig, ja fast erpresserisch werden. Dreiste Bettler wie in früheren Jahrhunderten gab es allerdings nur mehr selten; die meisten schämten sich ihres Zustands. Bei grossen und katastrophalen Unglücken, die sogar mehrere Familien betrafen, wurden, wie anderswo auch, spezielle Aktionen in Gang gesetzt, um den Betroffenen zu helfen.
2.4  Soziale Beziehungen, Konkurrenz und Solidarität
Soziale Beziehungen, Konkurrenz und Solidarität
Die oft beschriebene typische Streusiedlung im Appenzellischen – etwas weniger ausgeprägt in Obwalden und den übrigen nordalpinen Landschaften – mit ihren arrondierten und eingezäunten «Heimaten» hat einige auswärtige Beobachter zur Vermutung veranlasst, wir hätten es hier mit einer Gesellschaft von ausgeprägten Individualisten zu tun. «Hochburg des Eigenwillens» titelte Fritz René Allemann seinen Beitrag über den Kanton. 39Wollte man aber andererseits in den 1940er- und 50er-Jahren am späten Mittwochmorgen die Hauptgasse des Dorfes Appenzell queren, so kam man kaum über die Strasse und hätte, wie der Volksmund sagte, «auf den Köpfen gehen müssen». So dicht standen die Bauern jeweils dort zusammen. Individualismus und Gemeinsinn schlossen einander also nicht aus.
Die Frage nach der Solidarität wurde von den Interviewpartnern nicht selten etwas ausweichend beantwortet: Wer schon hätte unsolidarisches Verhalten und Konkurrenzdenken, erst recht dauernden Zank und Hader zugeben wollen, sei es auch nur bei anderen Mitmenschen? 40Ein derartiges Verhalten wäre Sünde und direkt gegen das christliche Liebesgebot gewesen. Auf den bestehenden, aber nicht in jedem Fall konfliktträchtigen Gegensatz zwischen der Mittelschicht und den wenigen Grossbauern wurde schon hingewiesen. Zu Konkurrenzdenken konnte vieles Anlass geben: Wer hatte die ansehnlichsten Häuser und Ställe, den grössten Landbesitz, die fettesten Alpen, die schönsten Kühe, die am reichsten geschmückte Sennentracht (im Appenzellischen)? Doch derlei dürfte allgemein verbreitet sein, fand nur in der Bauernschaft des Voralpengebiets seine spezifische Ausprägung. Gelegentlich wurde darauf hingewiesen, die Solidarität sei früher grösser gewesen als heute – eine Feststellung, die für den Kenner der gegenwärtigen agrarischen Welt wohl keines Kommentars bedarf. In der Tat war wie in anderen Gesellschaften die bäuerliche Nachbarschaftshilfe in Problemsituationen (Zeitbedrängnis beim Heuen, Unwetterschäden, Unglücksfälle usw.) früher selbstverständlich – sich abseits haltende Aussenseiter wären da noch mehr an den Pranger gestellt worden. Andererseits gab es natürlich immer wieder Schwierigkeiten beim alltäglichen Zusammenleben. Anlass zu letztlich nicht selten beim Richter endenden Auseinandersetzungen gaben etwa umstrittene Quellen- und Wegrechte. 41Jahrzehntelange Familienfehden wurden in den Gesprächen nicht erwähnt. Sie sind nicht auszuschliessen, waren aber in den Bergen aus nachvollziehbaren Gründen mutmasslich seltener als im Tiefland.
Während der Arbeit gab es im Allgemeinen wenig zwischenmenschliche Begegnungen bei den Bauern, abgesehen etwa von den unmittelbaren Nachbarn und dem Zusammentreffen bei der täglichen Milchablieferung. 42Die wichtigste Kommunikationsmöglichkeit waren der sonntägliche Kirchgang und andere kirchliche Veranstaltungen, worauf noch einzugehen sein wird. 43In Appenzell gab es ausserdem allwöchentlich den eingangs erwähnten Mittwochsmarkt, der wegen seiner Singularität 44etwas näher betrachtet werden soll, vor allem auch, weil hier neben der geschäftlichen und kommunikativen Funktion auch die barocke Komponente der Musse zum Zuge kommt: Der Mittwoch wurde nämlich auch «Bauernsonntag» genannt. Nach Erledigung der morgendlichen Stallarbeit machten sich an diesem Tag die meisten Innerrhoder Bauern zu Fuss, allenfalls mit dem Fahrrad, auf den Weg ins Dorf. 45Sie trugen ein Stoffsäcklein («Reissäckli») mit sich, in welchem sie für den Rückweg ihre Einkäufe verstauten. 46Der Markt war zunächst Viehmarkt – wer also ein Tier zu verkaufen hatte, nahm die vierbeinige Ware mit sich. Man besorgte Einkäufe, in erster Linie Lebensmittel (die ja im Appenzellischen abgesehen von den tierischen kaum selber erzeugt wurden), aber auch etwa Tabak, Eisen- und Lederwaren und dergleichen. Mit den Erlösen aus Verkäufen zahlte man fällige Rechnungen und Bankzinsen bar. Man besorgte amtliche Geschäfte und holte notwendige Informationen (insbesondere die aktuellen Marktpreise) ein. Vor allem aber wurde die Gelegenheit wahrgenommen, Alles und Jedes, mit wem auch immer, zu besprechen. Diese Kommunikation fand im Freien statt – eben in der Hauptgasse (was bedeutete, dass dort mindestens für Autos kaum mehr ein Durchkommen war), auf den Marktplätzen oder aber in den bei dieser Gelegenheit ebenso randvollen Wirtschaften. 47Diese wurden zwingend bei einem grösseren Handel aufgesucht, 48sonst je nach Einkommenslage oder aber auch nach Entfernung von zu Hause. Vermögendere assen dort eine der bekannten Appenzeller Würste und tranken Wein oder Bier, andere begnügten sich mit Suppe oder einem Kaffee mit Gebäck, viele kehrten gar nicht ein. Im Laufe des Nachmittags, nachdem vielleicht noch ein Jass 49geklopft worden war, traten dann die meisten wieder den Heimweg an, um rechtzeitig für die abendliche Stallarbeit bereit zu sein. Vereinzelte, die erst spät, nach ausgiebigem Jassen und durch allzu reichlichen Alkoholgenuss bisweilen eher schwankend ihr Heim erreichten, trafen auf allgemeine Verachtung und auf ein empörtes Eheweib.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Agrarische Religiosität»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Agrarische Religiosität» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Agrarische Religiosität» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.