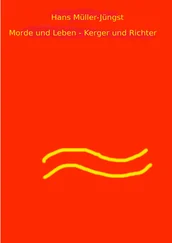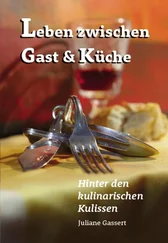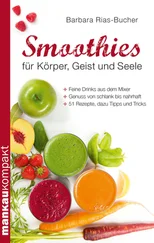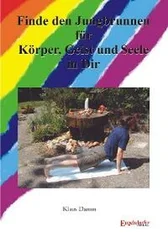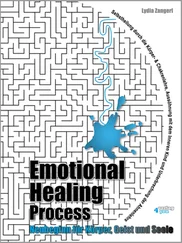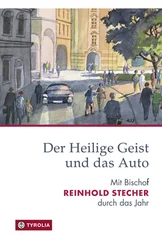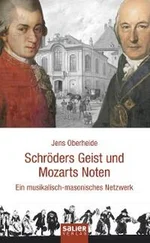Kennzeichnend für Simone Weil ist – neben der Christozentrik –, dass sie diese Erfahrungen mit ihrer eigenen spezifischen Situation und ihrem Denken als „ungetaufte Christin“ verbindet. Die Sehnsucht nach der (nur geistig empfangenen) Kommunion und ihre Liebe zum gesamten Universum treten aus solchen Texten deutlich hervor. Gleichzeitig geht sie über die rein äußere Beschreibung ihres Erlebnisses hinaus und schaut auf die Berührung Gottes mit der Welt. Hier kommt ihr zutiefst sakramentales Denken ins Spiel. Sakramente sind für Weil „Augenblicke der Ewigkeit“, das Band der Übereinkunft zwischen Gott und Mensch, wirkliche Berührungen Gottes mit der Welt, die sich besonders in der Schönheit zeigen. Ja, es gibt bei ihr so etwas wie eine „reale Gegenwart Gottes in allem, was schön ist.“ Sie nennt es „Sakrament der Bewunderung“. 8Auch die Freude, welche die Seele als Zustimmung zur Schönheit der Welt empfindet, kann für sie als Sakrament bezeichnet werden. Franz von Assisi war in diesem Sinn für Weil ein zutiefst sakramentaler Mensch.
Wenn Weil von Sakramenten spricht, geht sie somit über die sieben in der katholischen Kirche bekannten Sakramente hinaus. Der Heilige Geist soll die ganze Schöpfung entflammen. „Warum“ – so fragt sie einmal – „gibt es eigentlich kein Sakrament, dessen Materie das Feuer ist?“ 9Interessant ist auch die sakramentale Bedeutung, die sie dem vertrauten freundschaftlichen Glaubensgespräch zuschreibt. „Warum wird die Zusammenkunft von zwei oder drei Christen in Christi Namen nicht als Sakrament gesehen?“ 10Ein solches vertrautes Gespräch „mit größtmöglicher Konzentration und Aufmerksamkeit geführt“ ist für sie „genau so viel wert, wie das Beten des Breviers.“ 11
Auch die Eucharistie spielt eine große Rolle in ihrem Denken. Obwohl Weil die Eucharistie nie leibhaftig empfangen hat (die Messe besuchte sie allerdings schon seit 1935 häufig), hat sie eine tiefe eucharistische Spiritualität entwickelt. Der Blick auf Jesus in der konsekrierten Hostie ist für sie wie ein von Gott gewährtes Zugeständnis, „denn der Mensch kann die Fülle seiner Aufmerksamkeit nur auf einen sinnlichen Gegenstand richten“. 12Es ist der Blick auf die absolute Reinheit, auf das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg nimmt. Gott hat gleichsam seine verborgene und unfassliche Gegenwart in ein kleines Stück Brot gelegt, weil der Mensch ansonsten keine Möglichkeit hätte, der absoluten Reinheit und Schönheit selbst ins Gesicht zu sehen. „Dieses Teilchen Materie befindet sich im Mittelpunkt der katholischen Religion. Dies ist ihr größtes Ärgernis, und eben darauf beruht ihre wunderbarste Kraft.“ 13
Das Kreuz Christi schließlich verbindet Weil mit einem „Sakrament des Unglücks“. Ob es die armen Fischersfrauen in Portugal, die physischen Kopfschmerzen während der Karliturgie in Solesmes oder die Erfahrungen als Arbeiterin in einer Fabrik sind – immer haben der Schmerz und das Unglück für sie eine quasisakramentale Qualität. Sie vergleicht die Gegenwart Christi im Kreuz und im Unglück auch gerne mit der Eucharistie: „Wie Gott durch die Konsekration der Eucharistie in der sinnlichen Wahrnehmung eines Stückes Brot gegenwärtig ist, so ist er auch durch den erlösenden Schmerz, durch das Kreuz im äußersten Unglück anwesend.“ 14Deswegen ist für sie das Kreuz auch der bevorzugte Ort der Gottunmittelbarkeit und das Verlassensein von Gott, wie Jesus es am Kreuz durchlebt hat, kein Unglück, sondern Wohltat und Gnade. Tatsächlich fühlt sie sich in diesen Momenten ganz mit Christus eins, der am Kreuz der von allen (auch von seinem Vater) am tiefsten Verlassene war. 15
Die doppelte Liebe zur Schönheit der Schöpfung auf der einen sowie zu Kreuz und Leid auf der anderen Seite erklärt Weils starke Sympathie für Franziskus und Johannes vom Kreuz. Beide waren Poeten und Sänger der Schönheit und Liebe. Während aber Franziskus stärker für die Liebe zur Schönheit der Welt steht, ist Johannes vom Kreuz mit seiner Lehre der dunklen Nacht auch Gewährsmann für die Gotterfülltheit des Unglücks und Leids bis hinein in den Unglauben.
Kritik an Kirche und Christentum
Manches von dem, was Simone Weil außerhalb der Kirche hielt, ist durch die Theologie des 20. Jhs. und durch das II. Vaticanum im Sinne Weils weiterentwickelt worden. Sie hätte sich mit Sicherheit darüber gefreut, dass das Pastoralkonzil anders als die Vorgängerkonzilien kein einziges anathema sit mehr ausgesprochen hat, galt doch der Gebrauch dieser beiden kleinen Wörter für sie als das größte Hindernis für ihren Eintritt in die Kirche. 16Auch die letztlich positive Beurteilung anderer Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, besonders aber die Anerkennung eines „Strahls der Wahrheit“ in anderen Religionen wäre ganz in ihrem Sinn. 17Hätte Weil die Erklärung des Konzils über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen lesen können, wäre ihr der Schritt über die Schwelle der Kirche vermutlich leichter gefallen. 18
Andere ihrer Kritikpunkte und Anfragen sind hingegen ungebrochen aktuell. Da ist zum einen die Mahnung zur Entweltlichung: Für Weil war es das Grundübel des Christentums, dass es sich zu sehr auf die Macht des Römischen Reiches eingelassen und damit die dem Evangelium gemäße Armut und Unschuld verloren hat: „Die Schönheit der Welt ist im Christentum fast verloren gegangen, weil das Römische Reich aus ihm eine politische Religion gemacht hat.“ 19Eine solche Verweltlichung und Politisierung reicht bis in die Eschatologie: „Wie sehr muss das Römische Reich das Christentum vergiftet haben, damit sie das Paradies wie den Hof eines Kaisers beschreiben?“ 20Spätestens mit Konstantin habe die Kirche eine Macht gewonnen, die zur Folge hatte, dass sie ihre spirituelle Kraft – die sie in den ersten Jahrhunderten im Dialog mit der griechischen (v.a. platonischen) Philosophie noch hatte – mehr und mehr verlor.
Daneben kritisiert Weil v.a. das hebräische Denken, das für sie nationalistische Züge hat. Nur einige Stellen von Ijob, Jesaja, Daniel, Ezechiel und aus den Psalmen lässt sie als kompatibel mit der „wahren Religion der Liebe“ gelten. Das Grundproblem der Kirche liegt für Weil darin, dass „Israel und Rom dem Christentum ihren Stempel aufgedrückt [haben], Israel dadurch, dass das Alte Testament als heiliger Text übernommen wurde, Rom dadurch, dass es das Christentum zur Staatsreligion machte, was dem gleichkam, wovon Hitler träumte.“ 21Damit haben beide zur Entwurzelung des Christentums beigetragen und die Kirche trägt heute durch die Mission zur Entwurzelung der Völker Afrikas, Asiens und Ozeaniens bei.
Damit verbunden ist ein zweiter beständiger Kritikpunkt Weils, den man mit der (fehlenden) Demut vor dem Geheimnis bezeichnen könnte. Diese ist in der Kirche immer dann nicht zu spüren, wenn man das Übernatürliche gleichsam in Gebote, Gesetze, Dogmen und Verbote pressen möchte. Einer zu engherzigen Theologie fehlt es für Weil am Respekt vor dem Universum, in dem Gott verborgen und gestaltlos zugegen ist. In diesem Sinn sprechen die Christ(inn)en (und zwar sowohl Katholiken als auch Protestanten) manchmal zu viel von den heiligen Dingen, wo sie diese besser im Schweigen anbeten sollten.
In diesem Zusammenhang ist auch auf die so gen. kontextuelle Theologie und die Diskussion um die pluralistische Religionstheologie hinzuweisen. Wo steht Weil in dieser Diskussion? Für eine inklusivistische Position spricht bei ihr, dass ihre persönliche mystische Beziehung und Verehrung für Christus größer war als die für Platon, Herodot, Dionysos, Buddha, Krishna, Osiris oder andere Offenbarer der göttlichen Wahrheit. Für einen Pluralismus bzw. Universalismus spricht hingegen, dass sie von ihrem philosophischen Denken her eindeutig die Position vertritt, dass Gott in allen Religionen und Kulturen präsent ist, ja sie bezeichnet Osiris und Krishna „vielleicht“ als Inkarnationen des Logos vor Christus. 22
Читать дальше