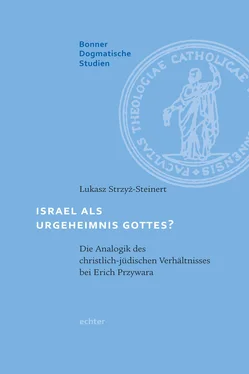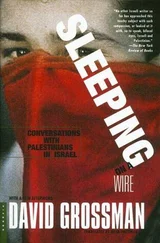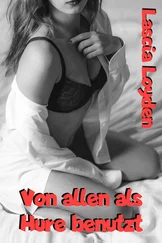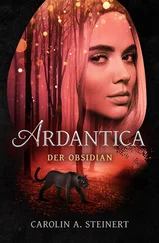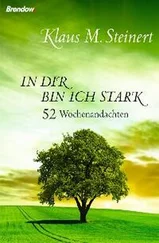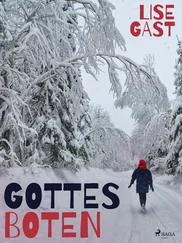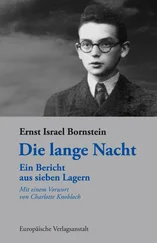210Siehe dazu S.M. BATZDORF, Edith Stein , 160–163; M. BÖCKEL, Edith Stein; R. SCHMIDBAUER, Edith Stein .
211Siehe dazu z.B. S. WEIL, Il fardello dell’identità.
212Nach K.-H. Wiesemann müsse „der innere, vielleicht nur äußerst mittelbar erkenn- oder erahnbare Nachhall , den diese geistig-geistliche Freundschaft auf höchsten Niveau in den Beteiligten und ihren Werken erzeugte“ beleuchtet werden: „Welchen Niederschlag findet etwa das eigentümlich schwebende und quirlig oszillierende Polaritätsund Analogiedenken des Jesuiten in dieser so gradlinig angelegten Konvertitin? Wo ist der innere Berührungspunkt zwischen beiden, ohne den es keine fruchtbare Beziehung geben kann?“ (K.-H. WIESEMANN, Edith Stein , 189). Im Zuge der Befragung für den Seligsprechungsprozess schreibt der betagte Przywara jedoch, ihre Beziehungen waren „rein philosophischer Natur“. „Natürlich haben Edith Stein und ich uns mehrfach in wissenschaftlichen Angelegenheiten gesprochen; nach ihrem Eintritt in den Orden sprach ich mit ihr ein einziges Mal im Karmel von Köln. Ein Briefwechsel nach ihrem Eintritt bestand nicht, weil unsere philosophischen Fragen erledigt waren“ (Brief an Prälat [J.] Queck (Erzbischöffliches Offizialat in Köln), vom 26. Mai 1968 [Abschrift], in: ArchDPSJ 47–182–923).
213 Vorwort in: RdG I., X.
214 Simmel – Husserl – Scheler , 34.
215 Begegnungen , 239.
216Über die vielen Erscheinungen des Antijudaismus siehe D. NIRENBERG, AntiJudaismus , bes. 97–143, 389–459. Über den Antijudaismus und Antisemitismus im Kontext der deutschen Philosophie der Neuzeit siehe D. DI CESARE, Heidegger , bes. 36–81. Eine bestechend ausgewogene und konsequente Analyse des traditionellen christlichen Antijudaismus als Schuldpotential im Kontext der Schoah findet sich in: G. LOHFINK – ‚ Maria – nicht ohne Israel , 45–57. Eine kompakte Übersicht der schwierigen und komplexen Beziehungen zwischen Kirche und Judentum bis zum Vortag des Zweiten Vatikanischen Konzils in: R.A. SIEBENROCK, Theologischer Kommentar , 618626.
217 Universeller Geist , in: Unser Oberschlesien 2 (1952) 5, zit. in: G. WILHELMY, Vita , 8.
218Vgl. G. ALY, Warum die Deutschen? , 105; O. BLASCHKE, Katholizismus und Antisemitismus , 65f. Eine differenzierte und behutsame Verortung dieses Phänomens bietet Ch. Kösters, der mit O. Blaschkes These vom für das katholische Milieu konstituierenden Antisemitismus polemisiert. Laut Kösters deuten die Forschungsergebnisse auf ein eher ambivalentes Verhältnis zu den Juden, die bis in die ersten Jahre des NS-Regimes keineswegs eine herausragende Rolle in der Wahrnehmung der Katholiken spielten. Auch die Methodologie der Forschung, aus der Blaschke die These von einer „bruchlosen Kontinuität eines katholischen Antisemitismus zwischen 1871 und 1945“ herleitet, scheint ungenügend. Die von Blaschke „für die Historisch-Politischen Blätter von 1838 bis 1919 und die Stimmen aus Maria Laach von 1871 bis 1919 insgesamt nachgewiesenen 604 bzw. 197 Seiten antisemitischen Inhalts machen jeweils deutlich weniger als 1% der Gesamtseitenzahl dieser Zeitschriftenjahrgänge aus“ und werden nicht in Verhältnis mit den anti-antisemitischen Stimmen gebracht. Kösters will damit den „Zusammenhang von katholischen Milieu und Antisemitismus“ nicht relativieren, aber die Erklärungskraft woanders suchen: „in den vielen Grauschattierungen getrübter, teilweise gänzlich verstellter Wahrnehmung der jüdischen Lebensschicksale; von der Aufnahme familiärer Verbindungen zwischen Christen und Juden abgesehen, war und blieb man einander fremd“ (CH. KÖSTERS, Katholische Kirche , bes. 37f). Siehe auch: TH. BRECHENMACHER, Katholischer Antisemitismus? . Viele persönlich formulierten Einsichten in das jüdisch-katholische Miteinander zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland und Österreich finden sich in: A. KOSCHEL (Hrsg.), Katholische Kirche und Judentum .
219O. BLASCHKE, Das Pianische Jahrhundert , 118f.
220R. SCHNEIDER, Verhüllter Tag , 155.
221Vgl. J. TAUBES, Brief an E. Przywara , vom 3. Januar 1953.
222 Brief an J. Taubes , vom 23. März 1953.
223Vgl. J. TAUBES, Brief an E. Przywara , vom 19. Oktober 1960.
224J. TAUBES, Die politische Theologie , 140f.
225 Ebd .
226R. FABER, „Theokratie von oben …“ , 63. „Taubes pflegte tatsächlich und mit Vorzug das Gespräch mit Antipoden, von Hans Urs von Balthasar über Eric Vogelin, Hans-Dietrich Sander und Armin Mohler bis Carl Schmitt“ (ebd., 89).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.