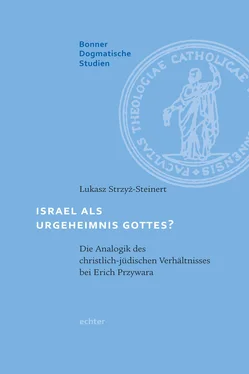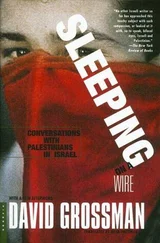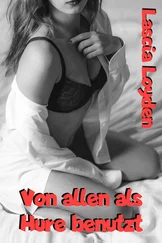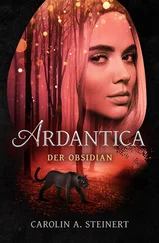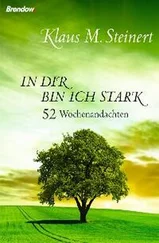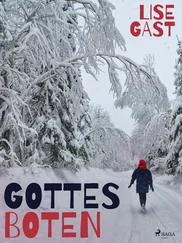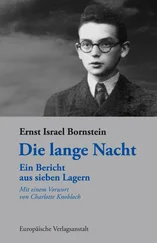183 Vorwort , in: IuG , 7.
184So schreibt er auch über Simone Weil, dass sie „nicht einfach nachdenkt, sondern selber eintaucht und untertaucht“ (Simone Weil , 75).
185Diese Methode hatte auch eine ganz praktische Konsequenz für Przywaras Arbeitsweise. Da er ununterbrochen die gelesenen ‚kernigen‘ Gedanken auf „kleine geordnete Zettel ausschrieb, […] entstand mit den Jahren eine ansehnliche Zettelbibliothek, die ihn sein Leben lang als wichtiges Rüstzeug begleiten sollte und zugleich bereits in der Auswahl der Stellen seine damalige Sicht des betreffenden Autors enthält“ (G. WILHELMY, Vita , 11).
186 Wege zu Newman , 29f. Ein anderer methodischer Leitsatz: „Bei Nietzsche, Scheler, Simmel, Newman hatte ich die Methode ausprobiert, von ihrem Ende her in den frühesten Anfang hinein zu sichten“ (Um Hölderlin , 132).
187 Analogia entis I , 51.
188 Vorwort , in: IuG , 9f.
189 Der Ruf , 93.
190Vgl. P. MOLTENI, Al di là degli estremi , 78f.
191Z.B. Simone Weil , 73.
192M. ZECHMEISTER, Gottes-Nacht , 93.
193H.U. VON BALTHASAR, Erich Przywara , in: L. ZIMNY (Hrsg.), Erich Przywara , 12.
194Vgl. L.B. PUNTEL, Analogie und Geschichtlichkeit , 549.
195F. KAUFMANN, Erich Przywara, Humanitas , 243 und 249.
196 Ebd ., 242.
197K. RAHNER, Laudatio , 272.
198K. BARTH – E. THURNEYSEN, Briefwechsel , II, 190.
199Im Vorfeld schreibt Barth an Thurneysen über seine Vorbereitungen für die Seminarsitzung, in der Przywara „dann einmal alles, was er über analogia entis etc. zu sagen hat, von Angesicht zu Angesicht vertreten“ sollte: „Aber auch da werden wir einen schweren Stand haben. Er ist ein Klügling durch und durch. Neulich hat Lollo [Charlotte von Kirschbaum] einen zweistündigen Vortrag von ihm gehört, in dem er alle unsere schönsten Register auch gespielt haben und nur zuletzt eben mittelst Thomas alles wieder eingewickelt haben soll. Lollo schrieb mir geradezu, sie habe den Eindruck gehabt, das sei der einzige, aber ein wirklich ernsthafter Gegner, den ich zu fürchten habe“ (ebd., 638).
200 Ebd. , 651.
201 Ebd. , 651–653. Thurneysen hatte ein Jahr später Przywara zu Gast gehabt und ihn im persönlichen Gespräch folgendermaßen erlebt: „beweglich und gescheit und nicht ohne eine gewisse menschliche Güte und Ansprechbarkeit. Wie eine Tanzmaus rannte er hin und her zwischen allen Gestalten der gegenwärtigen Weltbühne, heißen sie nun Heidegger oder Gogarten oder Buber oder Grisebach oder Husserl, benagte sie alle und äugte dann plötzlich aus dem eigenen Loch noch schnell siegreich heraus, um ungreifbar darin zu verschwinden. Dieses eigene Loch hieß diesmal: gratia praeveniens, hieß oboedientia potentialis, hieß gratia inhabitans, aber dies alles so raffiniert interpretiert, daß aller Pelagianismus gänzlich ausgeschlossen schien und einem alle die plumpen Kategorien, mit denen man ihn doch noch in die Falle zu bringen hoffte, gänzlich nebenabfielen. Man mochte noch so oft zum theologischen Bierjungen mit ihm ansetzen, man hatte kaum angesetzt, so war man auch schon ‚zweiter‘ Sieger. Ich glaube, mit dem würde der Teufel selber es verlieren. […] Sogar Fritz Lieb, den ich miteingeladen hatte, verstummte ob der großen Einsichten des Wasserpolaken, der alles immer noch ein wenig besser wußte und genauer kannte. Aber alles in allem ein ganz und gar vornehmes, urbanes und gelehrtes Gespräch. Es wurde unaufhörlich lateinisch gesprochen, es wurde sachkundig von der Orthodoxie und den Ikonen geredet, es wurde durchaus an keiner Stelle irgendjemand beleidigt oder direkt angegriffen. Es schimmerte durch alles hindurch beim Herrn Pater selber die große Sicherheit dessen, der auf dem unwandelbaren Felsen der Kirche eine wirkliche Zuflucht hat. Und so staunte man und bekam es fast mit dem Heimweh nach dieser ganzen erstaunlichen katholischen Möglichkeit, wenn nicht. ja, wenn nicht irgendwo ein letztes Grauen vor soviel Kunst in einem zurückgeblieben wäre“ (ebd., 708f). Zur Kontroverse zwischen Barth und Przywara siehe B. Dahlke, Die katholische Rezeption , 80–92, 124–129.
202 Oberschlesien , 12.
203Siehe vor allem A. FOA, Ebrei in Europa , 231f. Darüber hinaus siehe G. ALY, Warum die Deutschen?; T. VAN RAHDEN, Juden und andere Breslauer; T. WEGER, Niemcy, Żydzi i Polacy .
204G. Aly schreibt von einer generellen „deutsch-jüdische[n] antipolnische[n] Allianz, die bis in die Spätzeit der Weimarer Republik hielt“ (G. ALY, Warum die Deutschen ?, 64). Im ähnlichen Spannungsfeld suchten auch die Prager Juden in ihrer Zugehörigkeit zum deutschen Kulturkreis Schutz vor dem aufstrebenden tschechischen Nationalismus (Vgl. A. FOA, Diaspora , 85). Der wichtigste von ihnen mag Franz Kafka gewesen sein. Ohne seine Erfahrung, der jüdischen und zugleich der deutschsprachigen Minderheit in der überwiegend christlichen und slawischen Stadt der auseinanderfallenden Donaumonarchie anzugehören, sind seine Werke kaum zu denken. Als solcher symbolisiert auch er das Drama der jüdisch-deutschen Symbiose: „By the time Kafka died in 1924, only 5 per cent of the population of Prague were native German speakers. Most of them, like Kafka, were Jewish. And nearly twenty years later most of those, like his three sisters, were murdered in the Holocaust during the Nazi occupation of Czechoslovakia: it was, ironically, the Germans themselves who finally eliminated the German language and tradition in Prague” (N. MACGREGOR, Germany , 57f).
205Zit. als Titel in: M. BOLL – R. GROSS (Hrsg.), „Ich staune, dass Sie in dieser Luft atmen können“ .
206Begegnungen jüdischen und christlichen Geistes, in: H.J. SCHULTZ (Hrsg.), Juden, Christen, Deutsche , 239-–48. Vgl Rätsel Israel.
207Im Nachlass Przywaras befinden sich zwei Briefe Baecks an Przywara (ArchDPSJ 47–182–13) sowie zwei Abschriften von Przywaras Briefen an Baeck (ArchDPSJ 47–182–812) aus den Jahren 1954–55, die auf persönliche Kontakte vor dem II. Weltkrieg schließen lassen. „Oft einmal habe ich in den vergangenen Jahren an Sie gedacht und hatte gefragt wie es Ihnen wohl ergehe“, schreibt am 9. Februar 1954 Baeck, der sich für die vom Fritz Landsberger überbrachten Grüße und Wünsche bedankt. „Ihr Brief ist für mich eine der schönsten Überraschungen seit dem Beginn der bösen Jahre“, antwortet Przywara (beim angegeben Datum, dem 2. Februar 1954, handelt es sich offensichtlich um einen Fehler).
208 Begegnungen , 243.
209 Rätsel Israel , 101. „Nach der im Frühjahr 1933 verfügten Zwangsauflösung der Bündischen Jugend durch die Nationalsozialisten sammelte Schoeps deren jüdische Mitglieder in einer eigenen Organisation, dem Deutschen Vortrupp. Gefolgschaft deutscher Juden. Seine in diesem Rahmen entfalteten Unternehmungen zielten vorrangig darauf ab, die Zugehörigkeit der Juden zum Deutschtum bzw. zum Preußentum herauszustellen, und richteten sich vehement gegen alle Versuche, die deutsch-jüdische Symbiose zu entflechten, d.h. beide ‚Völker‘ zu ‚dissimilieren‘“ (F.-L. KROLL, Hans-Joachim Schoeps) , 110). Wie J.H. Schoeps schreibt, wollte sein Vater die damalige liberale Führungsschicht im deutschen Judentum durch konservative, „bündisch-soldatische Kräfte“ ersetzen, was jedoch nicht besonders ernst genommen wurde. Dem Versuch soll eine Fehleinschätzung der Situation, aber keine Absicht, mit Nazis zu paktieren, zugrunde gelegen haben (vgl. J.H. SCHOEPS, „Hitler ist nicht Deutschland“ , 232f. Vgl. Ders., Im Streit um Kafka).
Читать дальше