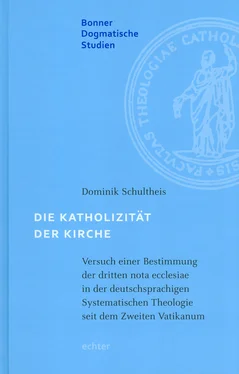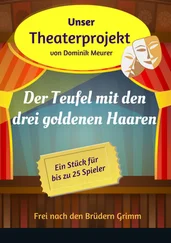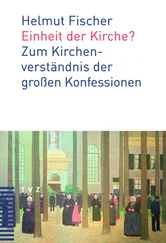LG 17 richtet schließlich ein kurzes Augenmerk auf die missionarische Tätigkeit der Kirche, die ebenfalls aus der extensiven Katholizität resultiert und im Dekret über die missionarische Tätigkeit der Kirche weiter entfaltet wird:
„In der Verkündigung der Frohbotschaft sucht die Kirche die Hörer zum Glauben und zum Bekenntnis des Glaubens zu bringen, bereitet sie für die Taufe vor, befreit sie aus der Knechtschaft des Irrtums und gliedert sie Christus ein, damit sie durch die Liebe bis zur Fülle in ihn hineinwachsen.“ Ziel und Aufgabe der Kirche ist es, „dass die Fülle der ganzen Welt in das Volk Gottes eingehe, in den Leib des Herrn und den Tempel des Heiligen Geistes“ (LG 17).
Als alle Völker, Rassen, Klassen und Geschlechter aller Orte und Zeiten umspannende „Communio“ ist die Kirche die Catholica, ein messianisches Volk, sichtbares Sakrament der Einheit der Menschen (LG 9). „Das neue Volk [Gottes] bildet in seiner Katholizität mit ihrer quantitativen und extensiven Bedeutung das Haus mit den vielen Wohnungen ab (Joh 14,2), von dem der Herr als Verheißung der künftigen Welt spricht.“ 423Die Heilszusage Gottes manifestiert sich ein für allemal im Erlösungstod Christi und realisiert sich je neu durch alle Zeiten und Orte hindurch, wonach die Katholizität der Kirche als geschichtlicher Vollzug zu begreifen ist, als Gabe und Aufgabe zugleich: „Die Katholizität der Kirche ist ihr eine von Gott zugesprochene Wirklichkeit […], die im geschichtlichen Spannungsverhältnis des Schon und Noch-nicht verbleibt.“ 424Sie bleibt „immer Aufgabe, auf die hin wir uns ausstrecken und so Auftrag, den wir nie ganz einholen“ 425, bis dass Gott die Kirche im Eschaton einst vollenden wird. So ist die Kirche als das Volk Gottes dessen eschatologische Sammlungsbewegung, in die alle Menschen aller Zeiten, Orte, Nationen, Rassen, Kulturen und Weltanschauungen gerufen sind. Die bestehenden Unterschiede werden dabei nicht einfach ausgelöscht, wohl aber relativiert: „Im Volk Gottes wird der eschatologische schalom unter den Bedingungen des gegenwärtigen Äon antizipiert. […] Als Volk Gottes ist die Kirche auf den staubigen Straßen der Geschichte unterwegs, um seiner ewigen Heimat und der eschatologischen Fülle der Zeit entgegenzugehen. Sie kann allein Gott selbst heraufführen. […][Damit wendet sich die Volk-Gottes-Ekklesiologie gegen jedwede innerweltliche Geschichtsutopie, sei sie westlich fortschrittlicher oder marxistisch revolutionärer Art“ 426.
In nachkonziliarer Zeit ließ ein horizontalistisch verflachter Volk-Gottes-Gedanke seinen theozentrischen Charakter in Vergessenheit geraten. Dies ließ das Leib-Christi-Sein der Kirche in den Hintergrund treten. Im Zuge der 68er-Bewegung wurde das Volk-Gottes-Sein der Kirche gar demokratisch gedeutet. Man vergaß, dass die Kirche kein rein innerweltlicher Verein, sondern Volk Gottes ist und dass die Rede vom Volk Gottes der Kirche keine rein soziologische, sondern eine theologische Größe zuschreibt. 427. Eine innerkirchliche Gegenbewegung war die Folge, die die neutestamentliche Begründung des Volk-Gottes-Gedankens zum Teil in Frage zu stellen versuchte und den Leib-Christi-Gedanken in teils einseitiger Weise prononcierte.
Bevor wir uns diesem zweiten Leitbegriff widmen, wollen wir uns in einem ersten Exkurs der schwierigen Verhältnisbestimmung von Israel als dem bleibenden Volk Gottes und der Kirche als dem „neuen“ Volk Gottes widmen, um wichtige Erkenntnisse für unsere Bestimmung der Katholizität der Kirche zu gewinnen.
3. Exkurs: Die schwierige Verhältnisbestimmung zwischen Jesu Sammlung des wahren Israels und der Kirche
Im Rahmen der bis hierher betriebenen Betrachtungen des Volk-Gottes-Begriffs, der vom Konzil in einer patrististischen Rückbesinnung wieder entdeckt und ins Zentrum seiner ekklesiologischen Reflexion gerückt wurde 428, bleibt ein kurzer Blick auf eine erste kontrovers diskutierte ekklesiologische Frage zu werfen, nämlich auf die schwierige Verhältnisbestimmung von Israel als dem von JHWH erwählten Volk Gottes zu der von Jesus Christus begründeten Kirche 429. Spätestens seit der viel beachteten Rede Johannes Pauls II. vor den Repräsentanten des deutschen Judentums in Mainz am 17. November 1980, in der er von einer „Begegnung zwischen dem Gottesvolk des von Gott nie gekündigten Alten Bundes (vgl. Röm 11,29) und dem des Neuen Bundes“ 430sprach, spielt die Frage einer exegetisch fundierten Bundestheologie eine immer wichtigere Rolle. Die Herkunft der Kirche aus Israel und ihre bleibende Heilsgemeinschaft mit Israel als dem wahren Volk Gottes vermochte das Konzil sowohl in der Kirchenkonstitution als auch in der Erklärung über das Verhältnis der katholischen Kirche zu den nichtchristlichen Religionen „Nostra Aetate“ nur bruchstückhaft zu reflektieren; die biblische wie systematische Theologie ist auf diesem Weg in den letzten vierzig Jahren zwar ein beachtliches Stück voran gebracht worden, kann aber – vor allem unter ekklesiologischen Gesichtspunkten – nicht als geklärt und abgeschlossen bezeichnet werden. Die entscheidende Frage lautet nach wie vor: Wie verhält sich die von Jesus Christus intendierte und in seiner Sendung verwirklichte Sammlung des wahren, endgültig wiederhergestellten Volk Gottes, des endzeitlichen Israels, zu der Kirche, die nach Ostern mit dem Pfingstereignis im Heiligen Geist zusammengeführt wird und sich zunehmend als eigene, von Israel verschiedene Glaubensgemeinschaft konstituiert? 431Kann – mit Rekurs auf die Heilige Schrift – (noch) von einer „Stiftung“ der Kirche durch Jesus Christus gesprochen werden oder ist deren Ursprungsgeschehen nicht schon und alleine in Israel als dem wahren „Volk Gottes“ begründet und vorausbedeutet? Dies aber weitet den Fragehorizont unweigerlich aus und ruft eine weitere Frage auf den Plan: Wie viele „Bünde“ Gottes mit den Menschen gibt es nach Christi Tod und Auferstehung überhaupt: einen oder zwei? Sind Juden und Christen Teile einer sich durchhaltenden Bundestradition, die von beiden in jeweils unterschiedlicher Weise angeeignet wird, also parallele Heilswege in ein und demselben Bund, oder muss von der Eigenart zweier Bundestraditionen ausgegangen werden, die in ihrer Diskontinuität beide für das volle Hervortreten der Gottesherrschaft von entscheidender Bedeutung sind?
Eine wie auch immer ausfallende Beantwortung dieser Fragen wird Auswirkungen auf unseren Untersuchungsgegenstand dergestalt haben, dass sie die Überlegung evoziert, ob die Katholizität der Kirche alleine und vornehmlich im Christusereignis gründet oder ob sie sich auch aus der Heilssendung des Volkes Israels ableitet, zu dem Gott zuerst gesprochen hat, was wiederum zur Folge hätte, dass Israel bzw. dem Judentum als nichtchristlicher Religion eine eigene Katholizität zuzusprechen wäre. Oder anders gefragt: Sind die christlichen Kirchen – bei aller Verwiesenheit auf das wahre Volk Israel – unabhängig von diesem „katholisch“, oder ist die Kirche – zumindest in anthropologischer und schöpfungstheologischer Hinsicht – „katholisch“ durch und aufgrund ihrer Verwiesenheit auf das Volk Israel hin, das ja nicht nur Ursprung und Vorausbild der Kirche ist, sondern ihre bleibende Wurzel, der Ölbaum, auf den sie aufgepfropft und dem die Christenheit eingepflanzt (vgl. Röm 11,16–24) wird? Diese Fragestellung erlaubt zumindest, über die Möglichkeit nachzudenken, ob die Qualifizierung des Verhältnisses von Altem und Neuem Bund nicht auch das Verständnis der Katholizität der Kirche einerseits und ihr Verhältnis zu Israel und dem Judentum andererseits differenzierter zu beschreiben vermag. 432
Um mögliche Antworten auf diese Frage zu erhalten, sollen nachfolgend der semantische und exegetische Befund zum Bundesbegriff und die daraus ableitbaren Bundestheologien sowohl im Alten als auch im Neuen Testament kurz umrissen werden. Auf eine breite, alle Teilaspekte berücksichtigende Darstellung muss im Rahmen dieser Untersuchung verzichtet werden. 433
Читать дальше