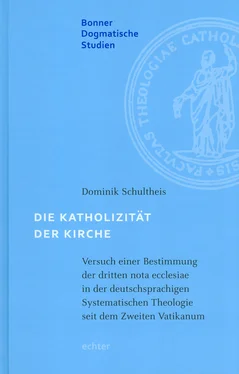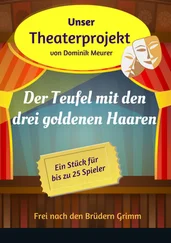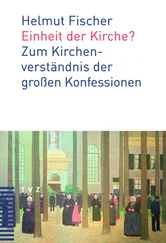Im Folgenden sei das Verständnis der Kirche als „Volk Gottes“ betrachtet, dem das zweite Kapitel der Kirchenkonstitution gewidmet ist.
2. Die Bezeichnung der Kirche als „Volk Gottes“ des Neuen Bundes
Gottes universaler Heilswille zielt auf alle Menschen, denn „er hat […] beschlossen, die Menschen zur Teilhabe an dem göttlichen Leben zu erheben.“ (LG 2) Dies macht die Hl. Schrift deutlich, wenn sie mit der Erschaffung der Welt beginnt: Deren erste Gestalt nämlich ist nicht Abraham, der Stammvater des 12-Stämme-Volkes, sondern Adam, der erste Mensch. Adam bezeichnet in der Genesis jedoch nicht einen bestimmten Menschen, einen Einzelnen, sondern den Menschen überhaupt, die Menschheit. 392Damit aber liefert die Genesis den Schlüssel zum Verständnis der gesamten Bibel: Sie schildert im Alten Testament nicht nur die Geschichte einer Beziehung zwischen JWHW und seinem auserwählten Volk des Alten Bundes, die sich im NT mit Christus auf die Kirche des erneuerten Bundes ausweitet, sondern die Gemeinschaft mit Gott, sein Heilswille, zielt auf alle Völker und ist universal . Es geht JHWH nicht zunächst und primär um das eine auserwählte Volk Israel, sondern um das ganze Menschengeschlecht, das ὅλον der Schöpfung, das Ganze: die Universalität (Katholizität) seines Heils. Diesem universalen Heilswillen Gottes entsprechend nimmt das Zweite Vatikanische Konzil den Begriff „Volk Gottes“ in seiner Kirchenkonstitution als Bezeichnung für die Kirche auf und bestimmt ihn „als eine universale Größe […], zu der alle Menschen gerufen werden (vgl. LG 13) und deren Haupt Christus als ‚inkarnatorisch vermittelte Unmittelbarkeit zu Gott‘ […] ist (vgl. LG 9)“ 393.
Konkret verwirklicht sich das Heil Gottes für die gesamte Menschheit in der Sammlung einer Heilsgemeinde, die ihren Ursprung in der Erwählung Abrahams hat (vgl. Gen 12,1–3) und die Johannes in der heiligen Stadt, dem neuen Jerusalem, verwirklicht sieht (vgl. Offb 21,2.24). Das Kommen des neuen Jerusalems, einer neuen Gesellschaft, der – symbolisiert durch die zwölf Tore, welche niemals geschlossen werden (Offb 21,25) – eine weltweite Öffnung zu eigen ist (vgl. in diesem Zusammenhang die Völkerwallfahrt zum Jerusalem der Endzeit in Jes 60,1–11), ist also an einen konkreten Ort und an eine konkrete Zeit gebunden, nämlich an das 12-Stämme-Volk und dessen Geschichte. 394Gott möchte die Erlösung der ganzen Welt und beginnt mit der Veränderung der Welt auf die erhoffte neue Stadt Jerusalem hin an einer bestimmten raumzeitlich definierbaren Stelle bzw. an einem Einzelnen: Abraham. In Abraham verändert der Glaube an den biblisch bezeugten Gott JWHW die Welt in konkreter Weise. Wenn es in der Genesis heißt: „Ein Segen sollst du sein. […] Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen“ (Gen 12,2–3), dann meint dies nichts anderes, als dass Abraham und das Neue, das JWHW mit ihm in der Welt beginnen lässt, denen, die mit Abraham in Kontakt kommen, zum Heil gereichen. Bei Erwählung des Abraham geht es nicht nur um ihn und um seine Sippe, sondern um das Ganze; aber damit das Ganze erreicht wird, die ganze Schöpfung, braucht es einen konkreten Menschen an einem konkreten Ort zu einer konkreten Zeit, der von Gott erwählt und mit dem Gott seinen Heilsplan veranschaulichen kann. Dabei handelt Gott nicht ohne die Einbeziehung derer, die er erwählt und sendet: Geht die Sendung zwar von Gott aus, die sich nur im Hören und im Sich-Öffnen für dessen Auftrag und Verheißung hin verwirklichen lässt, so gebraucht Gott keine Gewalt, damit sein Plan gelingen wird; Gott handelt stets unter der Bedingung, dass die Freiheit des Einzelnen respektiert wird und der Gesandte in Freiheit dasselbe wollen muss, was auch Gott will. Abraham lässt sich auf den Anruf Gottes ein – in Freiheit – und wird so zum Stammvater des Volkes, das Gott erwählt hat: nicht für sich selbst, sondern damit die anderen in diesem einen Volk erkennen, was eine aus dem Willen Gottes lebende neue Gesellschaft ist. Gott braucht in der Welt ein konkretes, sichtbares Volk, an dem er seine neue Gesellschaft veranschaulichen kann und erwählt dieses im Sinne der Sendung für die anderen.
Wenn sich die Kirche als „ecclesia“, d.h. als die „Versammlung“, als die „Herausgerufene“, in einer Kontinuität der Sendung Israels weiß, dann ist auch sie keine Versammlung von für sich selbst auserwählten Menschen, sondern eine Versammlung derer, die als Zeuginnen und Zeugen des in Jesus Christus inkarnierten Gottes auserwählt sind für die anderen . Diese aber ist die Kirche – in einer strukturellen Kontinuität zum einen, sichtbaren, konkreten auserwählten Volk Israel – als konkrete sichtbare Versammlung, als „sichtbares Gefüge“, das unablässig von Jesus Christus getragen wird. Jesus wollte nichts anderes, als Israel angesichts der nahenden Gottesherrschaft neu zu sammeln. Die Kirche ist gleichsam aufgerufen, sich ständig neu rufen, neu senden, schließlich neu sammeln zu lassen, was eine in ihrer irdisch-geschichtlichen Existenzform statische und abgeschlossene Kirche unmöglich macht. Die in der Kirchenkonstitution zu einem Leitbegriff gemachte Rede von der Kirche als „Volk Gottes“ (LG 14–16) ermöglicht so nicht nur ein Verständnis von Kirche, das die Kirche nur und ausschließlich deshalb als „Volk Gottes“ sieht, weil sie in einer strukturellen Kontinuität zu Israel als dem von JHWH ursprünglich erwählten Volk steht, sondern sie überwindet auch ein juridisch-hierarchisches Kirchenverständnis im Sinne einer „societas perfecta“, das die bleibende Sammlung der Kirche und ihre Öffnung auf das Ganze hin aus dem Blick verliert. Dies vermag Kirche aber nicht aus sich selbst, sondern es ist ihr geschenkt. Nur Christus kann das Ganze zusammenhalten und einen; er ist die eine Mitte, die alles trägt und sein Volk je neu um sich versammelt. Er kommt vom Vater und wirkt gegenwärtig in der Geschichte durch den Heiligen Geist, der von Christus Zeugnis ablegt und in alle Wahrheit einführt (Joh 15,26; 16,13). 395
Die Konzilsväter vermeiden bei der Aufnahme des Volk-Gottes-Begriffs in die ekklesiologischen Texte des Konzils bewusst, von einer Identität zwischen dem Theologumenon „Volk Gottes“ und (römisch-)katholischer Kirche zu sprechen. Absicht der Konzilsväter ist es nicht, mit der Verwendung des Volk-Gottes-Begriffs als Bezeichnung der Kirche den Anschein zu erwecken, als sei das „alte“ Volk Gottes durch das von Christus versammelte „neue“ Volk Gottes abgelöst und ersetzt worden; die alte klassische Substitutionslehre wird vom Konzil ausdrücklich nicht mehr bemüht. Die Konzilsväter wollen mit der Verwendung des Volk-Gottes-Begriffs gerade das bleibende Verhältnis der Christen zu ihren älteren Geschwistern zum Ausdruck bringen. In LG 16 ist daher – in einer gewiss etwas unglücklichen, da abgestuften Formulierung – von einer „Hinordnung“ der Juden auf das Gottesvolk die Rede. Unstrittig ist, dass das vom Konzil bemühte Attribut „neu“ nicht als Gegenstück zu einem missverständlichen „alt“ im Sinne von „überholt“ zur Verhältnisbestimmung von Kirche und Israel verstanden worden ist. Das Attribut „neu“ diente den Konzilsvätern in ihrer biblischpatristischen Rückbesinnung auf den Volk-Gottes-Gottes-Begriff vielmehr zur Korrektur einer übertrieben forcierten Leib-Christi-Ekklesiologie in der Pianischen Epoche. Die Ekklesia, so die Intention des Konzils, ist in Israel entstanden, sie versteht sich selbst als das endzeitliche, von Gott gesammelte Israel, als das „neue Volk Gottes“ 396(vgl. LG 9) und ist deshalb unlösbar und für immer mit dem ganzen Israel verknüpft. Die Kirche findet ihren heilsgeschichtlichen Ursprung nicht in einem einmaligen, durch Christus gesetzten Stiftungsakt, sondern vollzieht sich als ein gestufter Prozess, der nach Überzeugung der Kirchenväter – aufgrund des universalen Heilswillens Gottes – seinen Ursprung bereits in den Anfängen der Menschheits-Geschichte nimmt („ecclesia ab Abel“) und verborgen unter allen Völkern geschieht. 397Eine öffentliche Sammlung dieses Volkes beginnt mit der Berufung Abrahams und der Erwählung Israels, dem Vorausbild und Wurzelstock der Kirche, in den sie eingepflanzt wurde (vgl. Röm 11,16–24). 398Dass der vom Konzil bemühte Volk-Gottes-Begriff als möglicher Leitbegriff zur Verhältnisbestimmung von Israel und der Kirche aus heutiger Sicht nur noch schwerlich herangezogen werden kann, muss mit Erich Zenger zweifelsfrei eingestanden werden. Aus Sicht des Ersten Testaments ist der Begriff des Gottesvolkes, so Zenger, derart Israel-zentriert, dass er nur schwerlich als Leitbegriff zur Verhältnisbestimmung von Synagoge und Kirche noch als ekklesiologischer Grundbegriff verwendet werden kann. 399
Читать дальше