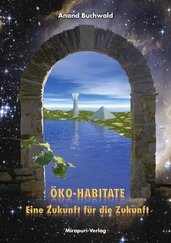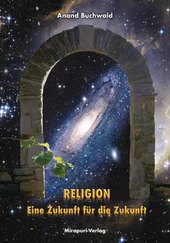Dieses Gespräch veränderte alles. Mein Vater flößte mir keine Angst mehr ein. Ich fing an, ihm eine unendliche Reihe von Fragen zu stellen, wir unterhielten uns stundenlang. Mir wurde bewusst, dass er uns bei all seiner Strenge und Unnachgiebigkeit innig liebte. Doch ich konnte mir nicht erklären, was mit ihm geschehen war. Er war immer so stark und unabhängig gewesen. Jetzt dagegen schleppte er sich nur noch dahin, er schien beinahe aufgegeben zu haben. Er klagte nicht über Schmerzen, sprach nicht von seinen Beschwerden, doch sein Körper war von der Krankheit gezeichnet. Er magerte zusehends ab und wurde immer schwächer. Die Durchfallattacken wurden immer häufiger, seine Haut war von Erythemen übersät und im Mund hatte er offene Stellen, die brannten.
Die Frau kam und wohnte in unserem Haus. Obwohl sie uns einigermaßen gut behandelte, änderte sich unser Leben. Sie gab uns nie Geld, und sie machte uns nie etwas zu essen, wie meine Mutter es immer getan hatte. Wenn sie kochte, dann nur für sich und meinen Vater. Wir drei mussten uns selbst versorgen. Ich sprach mit meinem älteren Bruder darüber und sagte zu ihm : »Schicken wir sie weg, sie kann nicht hierbleiben.«
Wir sprachen mit ihr, und sie antwortete sehr entschieden, dass sie keine Widerrede dulde und auf unsere Gefühle keine Rücksicht nehme : »Ich bin nicht euretwegen, sondern wegen eures Vaters hier, und für ihn ist es gut so.«
Wir waren inzwischen groß und bereit, Verantwortung zu übernehmen, und wir scheuten die Auseinandersetzung nicht : »Du bist wegen des Geldes hier ! Du interessierst dich doch weder für uns noch für ihn, geh weg !«
Ich und mein kleiner Bruder waren besonders angriffslustig, mein älterer Bruder war toleranter ; darin ähnelte er unserer Mutter. Das Leben zuhause wurde immer schwieriger. Die Frau kümmerte sich inzwischen auch um die Familienfinanzen und sogar Papa, so erschöpft er auch war, hatte begonnen, sich darüber zu beklagen. Wir waren hin- und hergerissen zwischen dem Drang, fortzugehen, und dem Wunsch, ihm beizustehen. Schließlich kamen wir überein, seinen Bruder zu rufen ; er war Clinical Officer *und konnte uns vielleicht helfen zu verstehen, woran er erkrankt war und was wir tun konnten, um ihm zu helfen.
Mein Onkel sagte uns, mein Vater sei nur deshalb so abgemagert, weil er wegen der offenen Stellen in seinem Mund nicht ausreichend Nahrung zu sich nehme. Papa antwortete : »Du bist ein Schwindler, du willst mir nicht die Wahrheit sagen. Ich habe Aids, und du willst es mir verheimlichen !« Obwohl die Symptome der Krankheit damals noch nicht so bekannt waren wie heute, war ihm sein Zustand voll und ganz bewusst.
Er ging nicht mehr ins Büro. Sein Lebenslicht flackerte von Tag zu Tag schwächer. Sechs Monate später starb er.
Innerhalb von wenig mehr als einem Jahr hatte unsere Familie aufgehört zu existieren.
Nach dem Tod meiner Eltern schien mein Leben keinen Sinn mehr zu haben. Ich dachte viel nach und blickte zurück. Papa hatte enorme Opfer gebracht, damit ich etwas lernte, er hatte mich an den besten Schulen angemeldet und alles getan, um mir ein unbeschwertes Leben und eine sichere Zukunft zu ermöglichen. Und ich ? Was hatte ich getan, um ihm das zu danken ? Nichts, absolut nichts. Und da stand ich nun, kaum 18 Jahre alt, ohne Eltern und ohne Perspektiven.
Doch zu unserem Glück hatte Papa für uns gesorgt und das große Haus im zehnten Bezirk, in dem wir wohnten, ohne unser Wissen gekauft. Wir blieben einige Zeit dort und vermieteten es dann, um Geld zu haben. Wir drei trennten uns. Lapken, mein kleiner Bruder, ging zu einem Cousin, mein älterer Bruder Keegan und ich jeweils zu einem anderen Onkel. Wir blieben alle in Lilongwe, doch unser Leben veränderte sich und war plötzlich mit Hindernissen angefüllt, die wir uns bis zu diesem Augenblick nicht einmal hatten vorstellen können. Solange ich noch zuhause gewohnt hatte, also bis zum Tod meiner Mutter, hatte ich nie einen Handschlag getan. Ich hatte mir um nichts Sorgen machen müssen und hatte alles gehabt, was ich brauchte. Die Hausangestellten hatten für uns geputzt, gekocht und gewaschen. Bei meinem Onkel war das anders. Ich hatte Pflichten ihm gegenüber. Ich musste mir Kost und Logis verdienen. Ich bekam nichts geschenkt. Ich stand jeden Tag um drei Uhr morgens auf, um das Haus aufzuräumen, Essen zu machen und die Wäsche zu waschen. Anders als mein Vater war mein Onkel nicht reich und hatte keine Angestellten. Manchmal gab es zum Frühstück nicht einmal etwas zu essen, sondern nur Tee. Ich war diese Einschränkungen nicht gewohnt und träumte von einem Teller Nsima .
In dieser Zeit begegnete ich meinem ersten Verlobten Wilson, einem ehemaligen Mitschüler. Nach der weiterführenden Schule war er nach Lilongwe gegangen und hatte die Universität besucht. Wir hatten uns zufällig getroffen und begonnen, miteinander auszugehen. Ich war glücklich, es ging mir gut. Ich erzählte ihm, was gerade alles passiert war, und schilderte ihm meine neue Welt. Er war sehr lieb und hatte gewisse finanzielle Mittel. Er fing an, mich zu unterstützen. Er brachte mir Essen und gab mir immer ein bisschen Geld, damit ich mir kaufen konnte, was ich brauchte. Er riet mir, niemandem davon zu erzählen : »Wenn sie es erfahren«, sagte er, »dann wirst du ihnen mit dem Geld ihre Gastfreundschaft bezahlen müssen, und dir wird nichts bleiben.«
Mein älterer Bruder, das neue Familienoberhaupt, erfuhr, dass ich verlobt war. Ich erklärte ihm, dass Wilson ein anständiger Junge war, ernsthaft und aufmerksam, und dass er nach seinem Studium eine Arbeit finden und mich heiraten würde.
»Ich freue mich für dich«, sagte er, »aber tu mir einen Gefallen : Denk auch an deine Zukunft.«
Ja, die Zukunft … Zum ersten Mal hing sie ausschließlich von mir ab. Sie lag in meinen Händen, ich war allein dafür verantwortlich. Ich sprach mit meiner Tante, und es gelang mir, sie zu überzeugen. Erneut schrieb ich mich an der Schule von Mzuzu ein. Das war für mich eine Möglichkeit, wieder in der Realität Fuß zu fassen, auch wenn diese Realität sich so rasch veränderte, dass man Schwierigkeiten hatte, Schritt zu halten. Während der Ferien oder am Wochenende kam ich zurück in die Hauptstadt und ging mit meinem Verlobten aus, doch ich fühlte mich unbehaglich : Ich begriff, dass ich so nicht leben, dass ich nicht immer von seiner Unterstützung abhängig sein konnte.
Am Ende des Schuljahrs begann ich in Mponela zu arbeiten.
Ich unterrichtete an einer privaten Sekretärinnenschule und war für ein praktisches Fach zuständig : die Daktylographie, die man damals noch fürs Maschineschreiben brauchte. Die Bezahlung war nicht fest, sondern hing von der Zahl der Kursteilnehmer ab. Die Schülerinnen zahlten die Kursgebühr an den Schulträger, der einen Anteil davon an mich weitergab. Manchmal verdiente ich fast nichts, manchmal lief es besser. Mir ging es gut damit : Ich konnte ein Zimmer mieten und war nicht mehr völlig von der Familie meines Onkels abhängig. Mein Verlobter war jedoch nicht gerade glücklich darüber, dass ich in Mponela blieb und dazu noch allein. Wir diskutierten und stritten uns. Beinahe hätten wir uns getrennt, doch er war zu verliebt, und so blieben wir am Ende doch zusammen. Doch etwas war zerbrochen.
Es ging mir gut in Mponela. Ich hatte viele Freunde, ich war unabhängig, und ich konnte für mich selber sorgen. Ich nahm mein Leben in die Hand, ich ging der Zukunft entgegen.
Mponela war eine große Ortschaft im Zentrum des Landes, und der Markt war ein konzentriertes Gemisch aus Gerüchen, Geräuschen und Farben. Dort lernte ich James, den Vater meiner Kinder, kennen. Er eroberte mein Herz im Sturm. Er war viel größer als ich, und bei ihm fühlte ich mich geliebt und beschützt. In den Tagen nach unserer ersten Begegnung behandelte er mich respektvoll und sanft. Obwohl alle schlecht von ihm redeten, machte ich mir nichts daraus und glaubte niemandem. Ich dachte, sie seien eifersüchtig und neidisch, weil ich einen schönen und freundlichen Mann gefunden hatte, der mich mit Aufmerksamkeiten überschüttete, aus einer guten Familie kam – sein Vater war Lehrer – und eine gute Stelle in einem staatlichen Büro bekleidete. Auch meine Verwandten waren nicht glücklich und wollten, dass ich nach Hause, nach Lilongwe, zurückkehrte, doch das interessierte mich nicht. Ich hatte den Richtigen gefunden. Und ich konnte über meine Zukunft entscheiden. Ich fühlte mich frei.
Читать дальше