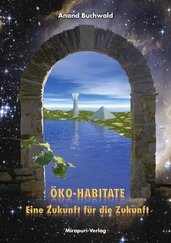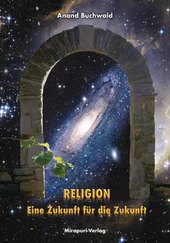Ich hatte ihn nicht erkannt, ich hatte keine Ahnung, wer er war. Ich machte Anstalten, weiterzugehen. Da nahm der Mann seine Sonnenbrille ab und lächelte breit. Es war Kondwani, ein alter Schulfreund, dessen Familie so arm gewesen war, dass sie meinen Vater oft hatte um Hilfe bitten müssen. Er war groß geworden : ein gut aussehender, kräftiger junger Mann, der mit einem teuren Auto herumfuhr und eine Sonnenbrille trug. Das bewies, dass man es auch in unserem Land zu etwas bringen kann, wenn man sich anstrengt, Glück hat oder das bisschen Hilfe, das man bekommt, zu nutzen weiß. Man kann sich aus einer Situation der Armut befreien und sein Leben in die Hand nehmen und selbst gestalten. Man kann sich eine Zukunft sichern. Ich weiß nicht, ob das oft geschieht. Ich glaube nicht. Aber die Möglichkeit besteht. Und das ist schon nicht wenig.
Mein Vater war sehr zornig über meine bescheidenen schulischen Erfolge. Er warf mir vor, ich hätte mir keine Mühe gegeben, ich hätte ihm schlecht gedankt für sein Vertrauen und für die Opfer, die er gebracht habe, und ich hätte ein so privilegiertes Leben gar nicht verdient : »Ich kann es einfach nicht glauben«, sagte er wieder und wieder, »dass du so oberflächlich bist !« Er meldete mich an einer anderen Schule an, die ebenfalls im Norden lag, in Mzuzu.
Das war weit weg, und so sah ich meine Familie selten, das heißt nur in den Ferien. Bei einem dieser Besuche erlebte ich den ersten echten Streit zwischen meinen Eltern. Nach diesem Streit – sie hatten einander angeschrien, und es waren böse Worte gefallen – kam meine Mutter zu mir und meinen Brüdern ins Zimmer und schlief dort auf dem Boden. Am Morgen danach war ihr Gesicht verweint und ihr Blick verstört. Ich fragte sie, was geschehen sei, doch sie antwortete nicht.
Am Tag danach fanden sich die üblichen »Eheberater« ein – die Verwandten, die sich immer einschalten, wenn ein Paar Probleme hat. Von meinem Zimmer aus hörte ich meine Mutter sagen : »Bevor ich so weiterlebe, gehe ich lieber wieder zurück in mein Dorf.« Ich spitzte die Ohren. Ich lauschte. Ich begriff. Vor unserem Umzug nach Mulanje hatte mein Vater ein Verhältnis mit einer anderen Frau gehabt, seiner Sekretärin. Meine Mutter hatte es herausgefunden und sich gewehrt : Sie hatte dafür gesorgt, dass mein Vater versetzt wurde. Unser Umzug, davon war sie überzeugt, würde der Affäre ein Ende bereiten – doch sie hatte sich getäuscht. Papa drängte seine ehemalige Sekretärin, ihre Stelle zu kündigen, bezahlte ihr die Schwesternschule in Mulanje – und traf sich weiterhin mit ihr.
Von da an sagte meine Mutter jedes Mal, wenn ich wieder zur Schule aufbrach, zu mir : »Pacem, wenn ich nicht mehr da bin, dann sei stark, sei ein braves Mädchen !« Ich war noch sehr jung, nicht einmal 18 Jahre alt, und hielt das Ganze für einen Scherz ; ich dachte, sie wolle mich provozieren und schauen, wie ich darauf reagierte. Als ich im Januar 1995 nach den Ferien wieder nach Mzuzu abreiste, sagte sie : »Pacem, ich werde bald sterben. Ihr werdet mit einer anderen Frau zusammenleben müssen, das wird nicht leicht sein. Kümmere dich um deinen kleinen Bruder.«
Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich dachte, sie wolle mich auf den Arm nehmen oder habe eine Depression. Es war das letzte Mal, dass ich sie lebend sah.
Den Rest der Geschichte habe ich erst nach ihrem Tod von meiner Großmutter erfahren.
Mama war krank gewesen, doch sie hatte mit niemandem darüber sprechen wollen. Auf eigene Faust hatte sie die besten Privatkliniken der Stadt aufgesucht und sich Medikamente verschreiben lassen. An einem Freitag im März war sie ins Bottom Hospital in Lilongwe gegangen. Sie fühlte sich derart elend, dass sie kaum laufen konnte. Man überwies sie sofort an ein anderes Krankenhaus, das Kamuzu Central Hospital. Gleich nach ihrer Ankunft kam eine Schwester in ihr Zimmer und bat sie um die Ergebnisse der im Bottom durchgeführten Blutuntersuchung. Meine Mutter gab sie ihr. Die Frau ging hinaus. Kurz darauf kam sie mit einer Kollegin zurück. Mama lag mit geschlossenen Augen da, schwach, abgemagert und kraftlos. Die Krankenschwestern dachten, sie sei eine ungebildete Frau, und unterhielten sich am Fußende ihres Bettes auf Englisch miteinander.
»Was sollen wir mit ihr machen ?«, fragte die eine.
»Nichts, sie ist HIV-positiv, da kann man nichts machen.«
Meine Mutter hörte zu. Sie verstand jedes Wort. Aids zu haben war damals ein sicheres Todesurteil. Es hieß, alles aufzugeben, es hieß, sich von jeder Vorstellung einer möglichen Zukunft zu verabschieden.
Als sie näherkamen und ihr einige Tabletten reichten, weigerte meine Mutter sich : »Ich habe euch zugehört, ich habe alles gehört. Ihr braucht mir nichts vorzumachen, diese Medikamente helfen nicht, ich kann nicht gesund werden.«
Die Krankenschwester versuchte sich herauszureden : »Aber nein, du irrst dich. Wir haben von einer anderen Patientin gesprochen.«
»Das ist nicht wahr«, schnitt sie ihr das Wort ab, »ich weiß, dass ihr von mir gesprochen habt.«
Sie beschloss, keine Medikamente und auch keine Nahrung und kein Wasser mehr zu sich zu nehmen. Bis mein Vater kam, sprach sie kein einziges Wort. »Was habe ich dir getan ?«, fragte sie ihn, als sie ihn eintreten sah. »Was habe ich dir getan«, wiederholte sie, »womit habe ich das verdient ?«
Mein Vater schwieg. Schuldbewusst.
Und Mama, zerbrechlich und erschöpft, zornig und verzweifelt, setzte hinzu : »Wer wird sich um meine Kinder kümmern ?«
Das waren ihre letzten Worte, ihre letzten Gedanken.
In den darauffolgenden Tagen verweigerte sie jegliche Therapie und Nahrung. An einem Montag um zwei Uhr rief mein Onkel in der Schule an. Er sagte mir, dass es meiner Mutter sehr schlecht gehe und ich rasch kommen müsse.
Er holte mich ab und brachte mich nach Hause, nach Lilongwe.
Mama war bereits tot.
Wir begruben sie in Chitipa, dem Dorf meines Vaters. So wollte es die Tradition.
Wenige Wochen später begann auch er sich schlecht zu fühlen. Er erkrankte an Tuberkulose, doch dank der Therapie wurde er gesund und kam wieder etwas zu Kräften. Ich hörte ihn oft weinen, vor allem nachts. Ich nahm all meinen Mut zusammen, holte tief Luft und fragte ihn, weshalb. Er antwortete, ich hätte mich geirrt, er habe nicht geweint. Noch am selben Abend hörte ich ihn wieder schluchzen und ging in sein Zimmer : Diesmal konnte er es nicht abstreiten. Er sagte, dass es ihm schlecht gehe und dass ich meinen Brüdern nichts sagen solle.
Drei Monate nach dem Begräbnis seiner Frau kam er mit einer Frau nach Hause, die wir nie zuvor gesehen hatten. Wir waren überrascht und fragten uns, wer das wohl sein mochte. Er stellte sie uns vor und erklärte, er wolle sie zur Frau nehmen. Für den Moment sagte niemand etwas. Wie schon gesagt : Mein Vater hatte einen harten und strengen Charakter, und es war sehr schwierig, mit ihm zu sprechen. Wir waren eingeschüchtert und hatten keine Möglichkeit, seine Entscheidungen zu beeinflussen. Doch die Krankheit veränderte ihn nach und nach. Die Strenge und Autorität, die er ausstrahlte, machten einer Verletzlichkeit Platz, die ich an ihm noch nie wahrgenommen hatte. Er tat mir leid. Ich fasste mir ein Herz : »Papa«, fragte ich ihn, »geht es dir schlecht, weil du wieder heiraten und diese Frau ins Haus bringen musst ?«
Er sah mir direkt in die Augen : »Pacem, es geht mir schlecht und es wird täglich schlimmer. Du kannst dich nicht um mich kümmern. Ich habe beschlossen, wieder zu heiraten, weil ich jemanden brauche, der mir hilft und der uns allen zur Hand geht.«
»Aber wenn du stirbst … wenn das passieren sollte … wird diese Frau dann für uns sorgen ?«
»Nein, das ist nicht ihre Aufgabe. Aber ich habe mein Testament schon gemacht«, sagte er, »und ihr werdet genug zum Leben haben.«
Читать дальше