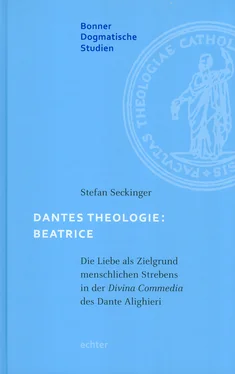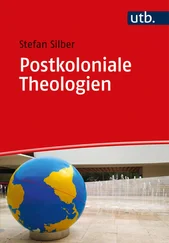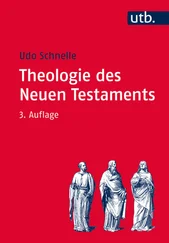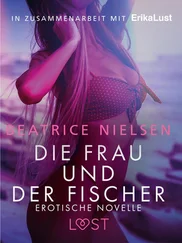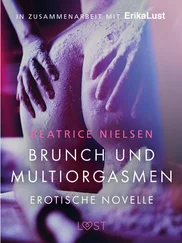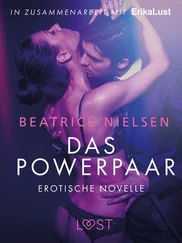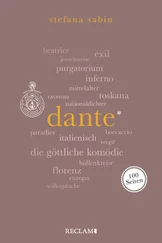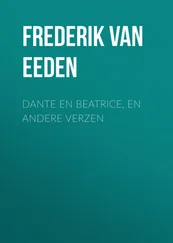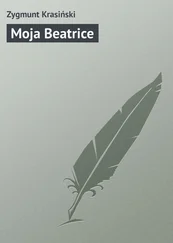Der Einzelne sieht sich in diese prinzipielle Zuordnung von natürlicher und übernatürlicher Gotteserkenntnis hineingestellt. Für Karl Rahner sind deswegen existentialphilosophische Überlegungen Ausgangspunkt seiner Thematisierung der Offenheit für Transzendenz als Konstitutivum des Menschen. Das entsprechende Verhältnis von Natur und Übernatur skizziert er in seinem ›Grundkurs des Glaubens‹. Nach Rahner interpretieren sich Natur und Übernatur gegenseitig, Natur und Gnade lassen sich adäquat jeweils nur vom anderen her bestimmen. 188Die Erfahrung von Transzendenz wird von Rahner wie folgt definiert : »Das subjekthafte, unthematische und in jedwedem geistigen Erkenntnisakt mitgegebene, notwendige und unaufgebbare Mitbewußtsein des erkennenden Subjekts und seine Entschränktheit auf die unbegrenzte Weite aller möglichen Wirklichkeit nennen wir die transzendentale Erfahrung .« 189Der Mensch ist demnach grundsätzlich offen für die Erfahrung einer Offenbarung Gottes 190, welche ihm seine eigene Existenz erst in rechter Weise deutet. Ausgehend von seiner sinnlich-begrenzten Erfahrungswelt gehört es zur apriorischen Struktur des Selbstbesitzes des Einzelnen, dass er in einem Vorgriff auf das Unbedingte seine raumzeitlich gesetzten Grenzen überschreitet. Auch wenn dies zunächst ein unthematisches Wissen von Gott ist, eine Ahnung und ein Verweis auf Gott als den Bezugspunkt aller transzendenten Erfahrung, so beschreitet Rahner im Grunde den Weg des Aquinaten in dem Bewusstsein der Verwiesenheit des Menschen auf einen ihn unendlich übersteigenden Sinnhorizont, von dem aber jegliche Orientierung und Sinnverortung abhängt. Im Vorgriff auf die Unendlichkeit Gottes ist diese selbst schon präsent als ein Geschenk von Ihm her »in dem Sinn der Seinsempfängnis, letztlich der Gnade.« 191Diese Vorahnung des Menschen auf die ihm von Gott her geschenkte Erfahrung der Seinsfülle charakterisiert auch seine Sehnsucht nach Erlösung. In der vorgrifflichen Erfassung des unbedingten Seins drückt sich die Hoffnung auf eigene Vollendung, auf die persönliche Hineinnahme in diese Unbedingtheit aus, die in der raumzeitlichen Bedingtheit des irdisch-endlichen Lebens nicht eingeholt werden kann. Daher nennt Rahner das in der transzendentalen Erfahrung zum Ausdruck gebrachte Wesensmoment des Menschen ein über natürliches Existential 192.
Auch Dante setzt für seine Divina Commedia diese gegenseitige Bedingtheit von Theologie und Philosophie, von Glaube und Vernunft, von Transzendenz und Immanenz voraus. So verleiht er etwa im 29. Gesang des Purgatorio den erworbenen (Natur) und eingegossenen Tugenden (Übernatur) einen bildhaften Ausdruck : Am rechten Rad des Triumphwagens der ecclesia (gezogen von Christus in der Darstellung eines Greifes als Bild seiner gottmenschlichen Natur) gehen in der Gestalt von drei Frauen die drei theologischen Tugenden, auf der anderen Seite sind es deren vier als Allegorien der vier Kardinaltugenden. 193Diese dichterische Verbildlichung der Tugendlehre des Aquinaten geht von einer kategorischen Zusammenschau der beiden Gruppen aus, unter eindeutigem Primat der Liebe : »[…] cum charitate simul infunduntur omnes virtutes morales.« 194
Dem Tugendverständnis der Commedia geht demnach eine oben skizzierte Auffassung des Ineinanders von Offenbarung/Glaube und natürlicher Gotteserkenntnis/Vernunft voraus, was allerdings primär in der Frage nach dem individuellen Heilsweg des Einzelnen anschaulichen Niederschlag findet. Glaube und Wissen sind in ihrem Bedingungsverhältnis derart aufeinander verwiesen, dass der Offenbarungsglaube nach seinem reflexiven Verständnis drängt, ohne damit von der Vernunft allein ableitbar zu sein (was gerade dem Wesen der Offenbarung als unableitbar-übernatürlicher Selbstmitteilung des dreieinigen Gottes in der Bedingtheit raumzeitlicher Weltwirklichkeit widersprechen würde).
Für den Jenseitsweg Dantes bleibt festzuhalten, dass von der Gnade her Natur als auf diese hingeordnet gesehen werden muss (was entsprechend für das Verhältnis von Theologie und Philosophie auszusagen ist) vor dem Hintergrund der Mysterialität des erlösenden Offenbarungsgeschehens. Der eigentliche Zielpunkt des eschatologischen Erkenntnisweges besteht jedoch im soteriologischen Moment, in der persönlichen Vollendung, die als denkerisch uneinholbar das Gebet und nicht die Abhandlung erheischt : »Der letzte Sinn der Philosophie liegt in der Theologie, der letzte Sinn der Theologie aber in der Heiligkeit.« 195
Hinsichtlich der Zuordnung Beatricens zur Theologie und Vergils zur Philosophie ist in diesem Zusammenhang auf das angekündigte Ende der Begleitung Vergils in Inf. I, 122–126 (da Vergil dem Kreis des limbus patrum zugehörig selbst der ewigen Anschauung Gottes verlustig ist) und v. a. auf Par. XIX, XX und XXIV 196hinzuweisen, wo Dante sein persönliches Glaubensbekenntnis ablegt 197. Stets gibt die übernatürliche, offenbarungsabhängige und gnadengebundene Gotteserkenntnis den Maßstab für die natürliche, vernunftgeleitete ; die Glaubensannahme (und die damit verbundene Umkehrbereitschaft) wird dadurch keineswegs zum sacrificium intellectus , vielmehr wird das unvoreingenommene Erkenntnisstreben des Menschen selbst erhoben, sodass er zu sich selbst (gemäß dem Verständnis des desiderium naturale bzw. der potentia oboedientialis ) 198kommt. Dante wiederum weist stets auf die Unableitbarkeit des Geheimnisses der personalen Rechtfertigungsgnade hin ; es geht ihm schließlich weniger um theoretische Spekulation als um die ermahnende und aufrüttelnde Darstellung des Einzelschicksals und seiner Bestimmung zur visio beatifica . Was demnach in der wissenschaftlichen Abhandlung theologischer Erkenntnissuche scheinbar klar und unzweideutig dingfest gemacht werden soll, ist in seiner konkret-individuellen Anwendung für den Dichter der mystischen Gottesbegegnung im Jenseits unausdrückbar, wodurch gerade seine Bitte im letzten Gesang der DC vor der Schau des ewigen Lichtes verständlich wird :
»O höchstes Licht, das über Menschensinne
So weit erhaben, leihe meinem Geiste
Ein wenig noch von dem, was du geschienen ;
Und mache meine Zunge also mächtig,
Daß sie ein Fünklein nur von deinem Glanze
Den künftigen Geschlechtern lassen möge.« 199
Auf der Ebene der Untersuchung der Handlung der DC erscheint es dem Interpreten notwendig, sich dem Anspruch dieser Selbstbescheidung anheimzustellen ; das Verständnis der Dichtung als belebende Darstellung der theologischen Lehre lässt sich kaum angemessen thematisieren, indem man von dieser Konkretheit und Anschaulichkeit wiederum einfachhin abstrahiert und in die reine Systematik zurückfällt. Das personal-emotionale Theologieverständnis in der Gestalt Beatricens in Analogie zu einem personal-inspirativen Philosophieverständnis im Auftreten Vergils zeigt, dass es dem Dichter nicht um repräsentative Personen dieser Wissenschaften ging (wozu Thomas und Aristoteles sich weitaus besser eigneten), sondern um ihn ansprechende Erfahrungen seines Lebens, wobei auch und gerade das Schicksal der beiden ihn prägenden Persönlichkeiten sein Interesse einnimmt (bei Vergil ist dies die Frage nach der Verdammung der ungetauft Gerechten bzw. nach der Gnadenwahl Gottes, in Beatrice sieht er seine eigene Erlösung unmittelbar angesprochen). Dass diese personale Ebene nicht die theoretische Grundlegung der theologischen Aussage überflüssig werden lässt, ohne diese gar nicht verstanden werden kann, soll in den folgenden – die theologische Systematik integrierenden – Erläuterungen zu den drei Liedern der Divina Commedia deutlich werden. 200
3 Die Sehnsucht des Menschen nach der Erfüllung seines Liebesstrebens als Maßstab seines Handelns : Paradiso
Читать дальше