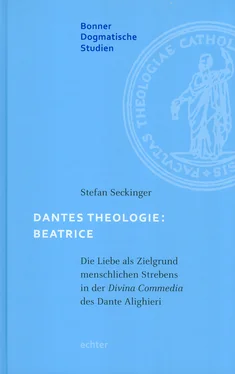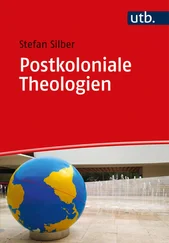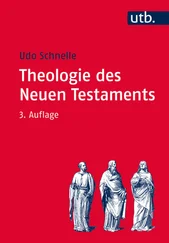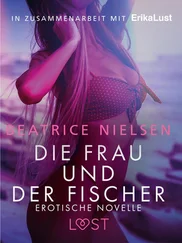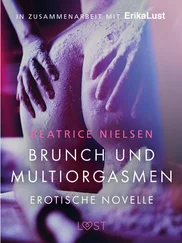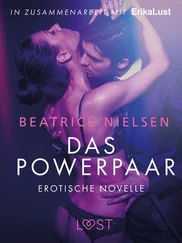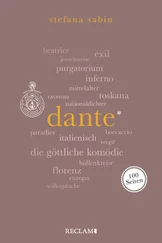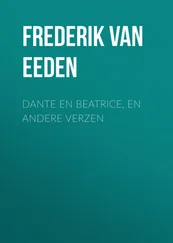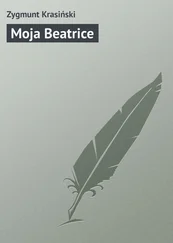Für einen hermeneutischen Zugang, der den Konstruktivismus bei der Untersuchung der Fiktionalität sprachlicher Repräsentationen berücksichtigt, erweist sich dieser Prozess als stets unabgeschlossen-offen, d. h. es kann ihm nie nur um vermeintlich rein Faktionales gehen. Wenn sich die fiktionale Darstellung an faktionale anlehnt, markieren daher beide notwendig diesen Konstruktionsprozess, da andererseits die reine Fiktion eine Begegnung von Text und Leser verunmöglichen würde, insofern sich eine solche immer an die Erfahrungswirklichkeit und -möglichkeit von Letzterem anschließt, darüber aber stets auch hinausgehend. So gilt entsprechend für eschatologische Aussagen, dass sie in Analogie zu irdischer Weltwirklichkeit stehen müssen, um überhaupt aussagbar zu sein. Gerade diese analoge Rede impliziert aber bereits ihr eigenes Ungenügen und ihre prinzipielle Unähnlichkeit mit dem Gemeinten, welches raumzeitlich eben nicht erfassbar ist.
Wenn nun Hans Vaihinger in seinem Hauptwerk Die Philosophie des Als-ob erkenntnistheoretisch Fiktion als bewusste Annahme nicht belegbarer oder gar falscher Tatsachen um ein bestimmtes Ziel zu erreichen akzentuiert, so stellt er ihre dienende Funktion heraus, d. h. auch ihre Verüberflüssigung nach Zweckerfüllung. Eschatologisch gesehen kann diese Sichtweise auf Dantes Werk wie auf alle eschatologischen Aussagen überhaupt übertragen werden, insofern sie auf etwas verweisen, das als solches raumzeitlich nicht eingeholt werden kann, sich daher als transzendental-jenseitig versteht und in einer angenommenen (geglaubten) Einholung nach dem Tod als überholt erweisen muss (und gegebenenfalls vor dem Hintergrund dieser Erfahrung auch als fehlerhaft, korrigiert). In diesem Zusammenhang ist der Verweis von G. Gabriel, dass fiktionaler Sprache Referenzialisierbarkeit ermangele 137, d. h. sie keine Referenz in der (positivistisch verstandenen) Weltwirklichkeit habe und daher keine reale Erfüllung aufweist bzw. intendiere, als Herausforderung zu sehen, eschatologische wie generell theologische Sprache neu zu überdenken. Wenn die Referenzialisierbarkeit fiktionaler Sprache ihren Gehalt auszeichnet und daher Kriterium ihrer Bedeutung ist, so kann theologisch-eschatologisch Sprache nur mittels der Referenz in der Existenz des Beteiligten und sich in den Dialog mit der Sprache Begebenden als gehalt- und bedeutungsvoll ausgewiesen werden. Die ausstehende Erfülltheit jenseitiger Verheißung verändert bereits im Diesseits den Rezipienten durch ihre Darstellung und Verkündigung. Die Ansage einer postmortalen Qualifizierung des eigenen (un)moralischen Handelns etwa hat Relevanz auf dieses in der prämortalen Existenz, insofern das transzendentale Gericht vom Subjekt geglaubt und persönlich präjudizierend angenommen wird, woraus sich Verantwortung wie auch Nächstenliebe erst in ihrem spezifisch christlichen Gehalt erschließen.
Die Funktionalität der Fiktion verweist in diesem Zusammenhang auf die hinter ihr stehende Intention, die etwa nach Searle die Differenz zwischen fiktionaler und nicht-fiktionaler Sprache kennzeichnet, die sich ansonsten nicht in ihrer Struktur unterscheiden. 138Wenn nun nach einer möglichen Intention in der Sprache gesucht wird, dann ist diese Suche nach ihrem Zweck und ihrer Absicht auch immer geprägt vom interessegeleiteten und erfahrungsabhängigen Blickwinkel des Suchenden. Konsequenterweise kann in dieser Sichtweise die Intentionalität der Divina Commedia aus konstruktivistischer Perspektive nicht beobachter- bzw. leserunabhängig erschlossen werden. Insofern kann auch nie die wirklichkeitsabbildende Intention Dantes letztlich definiert werden, vielmehr gilt es, stets neu Zugänge zu erschließen, die ausgehend von dem Text für eine wirklichkeitsschaffende und erschließende, eine suchende, dialogal-prozesshafte Intentionalität offen sind. Eine derartige Intentionalität steht immer unter einer Vorläufigkeit und lehnt sich so an den Vorbehalt aller eschatologischen Aussage an.
Damit ergibt sich als Ziel der vorliegenden Arbeit, unter Ausgangskenntnisnahme der sprachlich-philologischen und theologisch-eschatologischen Aspekte der Divina Commedia , die ›Intention‹ in einem konstruktivistisch-dialogalen Modus zu verorten, d. h. selbst die theologischen Aussagen als bedingte, interpretationsbedürftige und gerade so als über vermeintliche intentionale Festlegungen hinausgehende zu verstehen. In dieser Begegnung mit dem Text, in der Begegnung mit seinem Verfasser und dessen Begegnung mit Beatrice etc. kommt nämlich im Eigentlichen zum Ausdruck, worin die Intention eschatologischer Sprache besteht : in ihrer Vorsicht, ihrer eingestandenen Ungenügsamkeit, ihrem Vorbehalt.
Dantes ›Theologie‹ mit Beatrice gleichzusetzen meint insofern gerade nicht eine Gleichsetzung im Sinne einer objektivierbaren Erfassung oder klar umgrenzten Festmachung. Die Theologie des Werkes ist nur in aktueller Begegnung greifbar, verlangt den existentiellen Einbezug und das Sich-Einlassen des Lesers, der immer auch Interpret in konstruktivistischer Sicht ist, kann doch seine Subjektbefindlichkeit, sein Fragen und bisheriger Erfahrungsstand davon nicht abstrahiert werden. Es geht daher nicht um die Herausstellung einer besonders gearteten Theologie oder gar einer vermeintlichen Theologie an sich (die es in ihrer Geschichte nie gegeben hat), sondern um das Moment personaler Auseinandersetzung, ohne die es Theologie im Sinne des Einbezugs der eigenen Existenz (des eigenen Glaubens, Hoffens und Liebens) nicht geben kann. Von daher lässt sich sagen, dass die Theologie Dantes, die Theologie der Divina Commedia , eine eschatologische in Inhalt, mehr noch aber der dichterischen Gestalt nach ist, deren Dreh- und Angelpunkt – die Begegnung mit Beatrice – hervorhebt, wie Poesie die Liebe, die Gott selbst als ihr Zielgrund ist, adäquater verdeutlicht, als eine diese Poesie analysierende Theologie in ihrer vermeintlichen Objektivierung dessen, was nur im Modus des Erlebens und Empfindens wahrhaft zum Ereignis wird.
2 Grundlegung : Die Verirrung im Wald oder die Ausweglosigkeit in der Lebenskrise
2.1 Das Gefühl, etwas im Leben verpasst zu haben
Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura ,
Chè la diritta via era smarrita .
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura ,
Esta selva selvaggia ed aspra e forte ,
Che nel pensior rinnova la paura !
Tanto è amara, che poco è più morte ;
Ma per trattar del ben ch’io vi trovai ,
Dirò dell’altre cose ch’io v’ho scorte .
Io nor so ben ridir com’io v’entrai ,
Tanto era pien di sonno in su quel punto
Che la verace via abbandonai . 139
Der Einleitungsgesang der Commedia – der als solcher vor alle ihre Gesänge gestellt ist und dessen eingeschlagener Bogen erst im letzten Gesang (Par. XXXIII) zu seinem Endpunkt kommt 140– beginnt mit der Schilderung von Dantes Verirrung im Wald. In der Mitte seiner Lebensreise steht der Dichter mit 35 Jahren 141vor der vermeintlichen Orientierungs- und Ausweglosigkeit seines Daseins, er hat seinen Weg verloren. Der dunkle Wald 142ist ebenso allegorisch zu sehen wie der verloren gegangene Pfad ; der Wanderer sucht nach (s)einem wegweisenden Lebensziel in dem Moment, da er sich in die Dunkelheit irdischer Wirrnisse verläuft. In ihr wird ihm seine Situation der Krisis bewusst, die er allein nicht überwinden kann. Seine Abwendung vom direkten Weg ( diritta via , V.3) beschreibt er später im irdischen Paradies des Läuterungsberges beim ersten Wiedersehen mit Beatrice, die zu ihm spricht. 143
Dantes Lebenskrise, seine Verirrung und Abweichung vom rechten Weg, ist somit zunächst auf den Tod seiner Jugendliebe ( sol che pria d’amor ) 144zurückzuführen, die in das zweite, bessere Leben hinüberging (wodurch sie an Schönheit und Tugend noch zunahm). Beatricens Tod wird in der Dichtung mit dem Ausbleiben der Möglichkeit ihres Anschauens gleichgesetzt, sein Ideal ist ihm aus den Augen und somit aus dem Sinn geraten 145, er trägt mit der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen auch die Hoffnung auf ein gelingendes Leben zu Grabe. 146
Читать дальше