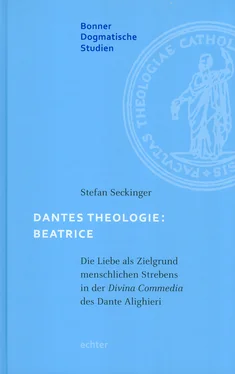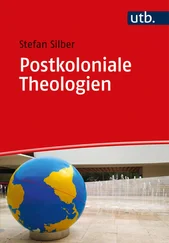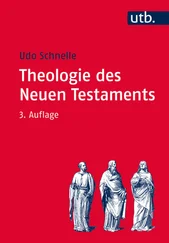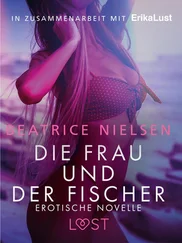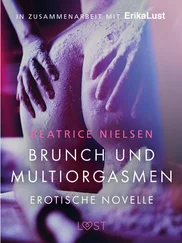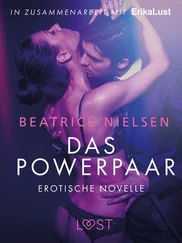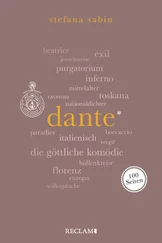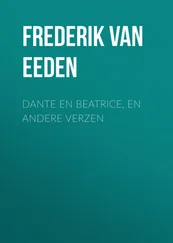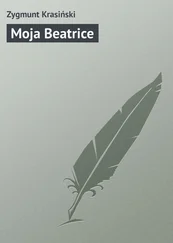Auf der anderen Seite wird deutlich, dass mit Dante auch die christliche Eschatologie nicht von einem ›Als Ob‹-Verständnis ausgeht. Auch wenn man die DC so lesen kann, dass damit im Diesseits für Dante unerreichbare Ideale aufrechterhalten werden, so lebt sein Werk gerade dadurch, dass ihr Autor von der Existenz und schließlichen Einholung dieser Ideale (im Jenseits) überzeugt ist. Für Dante ist niemals der Weg das Ziel ; vielmehr bestimmt umgekehrt das Ziel den Weg : Die Anschauung Gottes in der Ewigkeit wird ihm zum Kriterium für alles davor und danach in Diesseits und Jenseits Erfahrene. Zugleich gilt aber auch, dass Dantes Gedankenwelt nicht als objektiv wirkliches Geschehen verstanden werden kann. Es steht in Analogie zu irdischer Welterfahrung und stets unter dem eschatologischen Vorbehalt, der ja gerade auch für eschatologische Aussagen selbst gilt. Seine Dichtung ist auch er-dichtet. Erdichtete Vorstellungen sind aber immer mit Phantasie und Realitätsübersteigerung vermischt. Wenn man Dante und die ihm als Korrektiv mitgegebene Eschatologie der Theologie als begründete Hoffnung auf eine Wirklichkeit hinter bzw. über der diesseitigen ansieht, so kann man die folgende Aussage Vaihingers auch als Reverenz für Dantes Divina Commedia lesen : »Die Religion der Zukunft kann nur als Dichtung stehen bleiben.« 134Dem Leser bleibt es zu entscheiden, ob in der Dichtung mehr Wahrheit seiner existentiellen Hoffnung steckt als in der sogenannten Wirklichkeit dieser Welt. 135
1.10 Hermeneutik in konstruktivistischer Perspektive als Bezugsrahmen der theologischen Interpretation der Divina Commedia
Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, die Göttliche Komödie als (auch) theologisches Werk herauszustellen. Damit wird implizit ihrem Verfasser Dante theologische Kompetenz zugestanden, er selbst als ›Theologe‹ ausgezeichnet. Die folgenden Ausführungen, die sich an einen Gang durch das gesamte Werk anlehnen – allerdings beginnend mit den Gesängen des ›Irdischen Paradieses‹ aufgrund der eschatologisch-bedeutsamen Perspektive des Paradieses als Ziel und somit Maßstab aller Jenseitsvorstellung – setzen jedoch keine spezifische Theologie voraus, die sich ja nach zeitlichem Kontext und kultureller Einbettung sowie individueller Präferenz des jeweils Theologisierenden auch divergierend und damit für den binnentheologischen Diskurs gewinnbringend und innovativ präsentiert.
So bietet auch die Divina Commedia keine umgrenzte, systematische Theologie ; als Dichtkunst leben alle theologischen Aussagen geradezu von ihrer bleibenden Symbolkraft, Fiktionalität und Interpretationsbedürftigkeit. Dante bietet auch unabhängig von der lyrischen Form keine typisch mittelalterlich-scholastische Theologie. Er denkt selbstständig und zuweilen auch mutig, wenn er etwa Heiden ins Paradies und Päpste in die Hölle versetzt. Der theologische Beitrag und Akzent der Göttlichen Komödie liegt daher weniger auf ihrer inhaltlichen Ebene als vielmehr in der Art und Weise ihrer Vermittlung, die stets personal in Begegnungen geschieht.
Der Anspruch dieser Arbeit, die Liebe als Zielgrund menschlichen Strebens in der Divina Commedia zu untersuchen, fokussiert also keine Theologie im Sinne eines geschlossen-systematischen Systems, vielmehr den personalen Bezugspunkt des Werkes und der darin aufscheinenden theologischen Qualifizierung, ist doch der ›Gegenstand‹ aller Theologie personal, Gott als Beziehung gar trinitarisch und dreipersonal.
Wenn die Liebe als Grund und Ziel menschlichen Strebens ausgezeichnet ist, dann birgt somit zunächst ihr Antriebs- und Sehnsuchtsmoment im Spannungsgefüge eines ›Wovonher › (Dantes Erfahrung mit der irdischen Beatrice) und eines ›Woraufhin‹ (die Liebe des dreieinigen Gottes als Hoffnung auf Erfüllung der Kontingenz irdischer Liebe) entscheidenden Wegcharakter, wobei Beatrice in ihrer Bedeutung innerhalb der Göttlichen Komödie diese dynamische Liebesbewegung ermöglicht und versinnbildlicht. Dantes Jenseitsweg ist insofern auch immer schon Ziel, als durch das Geleit Beatricens die Dynamik der Liebe immer weiter gesteigert wird bis sie zurücktritt, da sie selbst nur Ermöglichungsgrund ist für und Hinweisfunktion hat auf Gott, der die Liebe ist.
Ausgangspunkt bleibt jedoch die Person Dantes, die wir aus heutiger Perspektive nicht letztlich als solche in ihrem historischen Befinden und ihrer Intentionalität herausstellen können, die Bedeutung Beatricens für ihn (in ihrer Differenz aber auch notwendigen Integration von irdischer und himmlischer Erfahrung) wie auch alle anderen Begegnungen im Werk. Dazu kommt entscheidend die Begegnung des Lesers mit den Personen des Werkes hinzu, bedingt durch seine jeweilige Subjektivität und entsprechende Perspektive, was einen hermeneutischen Bezugsrahmen verlangt, der die subjektbedingte Verfassung menschlichen Erkennens und Empfindens als Voraussetzung jeglicher Interpretation anerkennt. Hierzu bietet sich der Konstruktivismus mit seinem Verständnis der Beobachtungs- und Erfahrungsabhängigkeit des Weltverstehens an.
Zunächst nimmt das lebendige Beziehungsgeschehen (des Autors mit seinem Werk, der Personen im Werk, des Lesers mit dem Werk) seinen Ausgangspunkt aus der Dichtung in ihrer eigenen Dynamik und ihrem prinzipiellen Verweischarakter (entsprechend der immer wieder betonten Unzulänglichkeit von Dantes eigenem künstlerischen Schaffungsvermögen) auf das ausstehende Erkennen, welches Gnade und damit vom menschlichen Erkenntnisvermögen letztlich doch unableitbar ist. Der Dialogpartner dieser fiktiven Jenseitsdichtung ist der sich in diese jenseitige (und damit vorbehaltliche) Vorstellungswelt mit hineinbegebende Leser und Interpret. Dantes Konstruktion bzw. Fiktion ist damit Ermöglichung und Einladung für den Leser, sich in diese Konstruktionalität und Fiktionalität mit hineinzubegeben, niemals vergessend, dass er selbst wiederum nicht vorurteils- und interessensfrei seine Begegnung mit Dante und seinem Werk konstruiert. Der zirkuläre Konstruktionsprozess erweist sich vor diesem Hintergrund als stets neu gestaltbar und prinzipiell unabgeschlossen. Das Interesse der Perspektive der Begegnung des Lesers mit dem Werk nimmt somit gerade diese Beziehung in den Blick in ihrer beidseitigen Bedingtheit.
Die vorliegende Dissertation mit ihrem theologischen Bezugspunkt bringt die Sichtweise des gläubigen Rezipienten mit ein und erweitert durch diese Subjektorientierung den literatur- bzw. philologiehistorischen Zugang. Der Text der Dichtung wird damit zum Anlass einer konstruktivistisch fundierten Auseinandersetzung, als Gegenstand wird er als Voraussetzung hierfür zum Ausgangspunkt konstruierender, subjektbedingter Dynamik des Verstehens und vermag so existentielle Bedeutsamkeit zu gewinnen.
Die Fiktionalität der Divina Commedia steht allerdings ihrem Wahrheitsgehalt nicht entgegen, insofern konstruktivistisch Wahrheit immer eine er- und gefundene ist. Die Wahrheit erschließt sich in der Konstruktion der oben angesprochenen Zirkularität von Text und Leser in einem beidseitig und gegenseitig sich erschließenden Konstruktionsprozess. Fiktion ist damit mehr als willkürliche Erfindung einer nicht als real gesicherten Wirklichkeit, sondern durch die mit ihr verbundene und zu suchende Deutung ihrer Aussage wächst aus ihr Bedeutung in der Auseinandersetzung (Begegnung) der sich dabei konstruierenden existential-bedeutsamen Inhalte.
Auch die poststrukturalistische 136bzw. dekonstruktivistische Position zur Fiktionalität von Sprache geht von der Korrelation Ersterer mit der sozialen Wirklichkeit und dem Subjektempfinden der Rezipienten (die stets auch Konstruierende sind, insofern die dargebotene Sprache durch sie verstanden, interpretiert wird und weiterführende Versprachlichung findet) aus. Wenn Sprache Realität erst erschließt und kontingente Möglichkeitsräume für den Lesenden (wie Sprechenden, Hörenden) schafft, dann ist ihr innovativ-kreativer Anspruch und ihre Aufnahme selbst wirklichkeitsverändernd und -setzend. Sinnkonstruktionen erweisen sich daher als prinzipiell offen und veränderbar. So verweisen die poststrukturalen Konzepte der Fiktion auf die Bedeutung der Sprache als (Er)Dichtung, als Ausgedachtes, da eine derartige Entlarvung der Sprache als Fiktion zugleich über die Frage nach der realen Vorfindbarkeit des Ausgesagten in der materialen Weltwirklichkeit hinaus verweist. Die Phantastik von Dantes Jenseitswelt lehnt sich ja zunächst an die Realistik der irdischen Welt an. Sprache erweist sich darüber hinaus jedoch als weltgestaltende sowie werthaltige Position, ist performativ.
Читать дальше