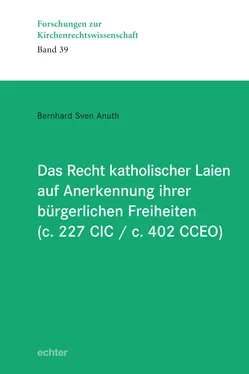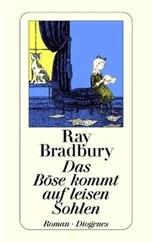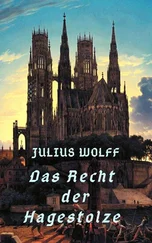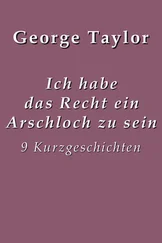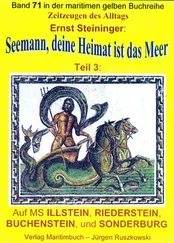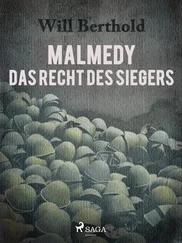Bei der Auslegung des c. 227 CIC und c. 402 CCEO und der in Verbindung damit einschlägigen Bestimmungen sind die gesetzlichen Interpretationsregeln zu befolgen. 66Besondere Beachtung verdienen dabei c. 17 CIC bzw. c. 1499 CCEO. Demnach sind kirchliche Gesetze zu verstehen gemäß der eigenen Bedeutung ihrer Worte in Text und Kontext (1. HS). 67Erst wenn die philologische bzw. grammatikalischlogische Interpretation 68eines Gesetzes nicht zu einem klaren Ergebnis führt, der Gesetzestext also zweifelhaft und uneindeutig bleibt, darf gemäß dem 2. HS subsidiär auf etwaige Parallelstellen, auf Zweck und Umstände des Gesetzes sowie auf die Absicht des Gesetzgebers zurückgegriffen werden. 69Diese Auslegungsregeln galten weitgehend identisch schon im CIC/1917. Ihre Übernahme in den CIC/1983 und entsprechend in den CCEO ist „als bewußte methodologische Entscheidung des Gesetzgebers“ 70zu verstehen. Der/die Interpret/in ist an sie gebunden.
Dieser Ansatz einer kodexkonformen Auslegung ist in der Kanonistik umstritten. Seine Kritiker(innen) sehen darin „a new kind of positivism“ 71bzw. einen „normativistische[n] Positivismus“, der „dem Wesen der Rechtsordnung nicht gerecht wird“ 72.
Dagegen wird eine theologische, von den Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils, insbesondere seiner Ekklesiologie, geprägte Auslegung des kanonischen Rechts stark gemacht. Schließlich, so Papst Johannes Paul II., mache diese Ekklesiologie auch „das Neue im neuen Codex“ 73aus. Zwar hat sich dieses Neue, wie Remigiusz Sobański feststellt, „nicht auf die auslegerische Diktion ausgewirkt“ 74. Dennoch fordern namhafte Kanonist(inn)en und Theolog(inn)en nachdrücklich eine Interpretation der Gesetzestexte im Geist und Licht des Zweiten Vatikanischen Konzils. 75Libero Gerosa vertritt gar die Meinung, eine theologische Interpretation der kanonischen Gesetze werde „nur von jenen ‚progressiven‘ oder ‚konservativen‘ Kanonisten zurückgewiesen, die durch eine ihnen gemeinsame Überbetonung der positivistischen Auffassung des Kirchenrechts bestimmte kirchenpolitische Anliegen und Ausrichtungen verteidigen wollen.“ 76Für den Dogmatiker Bernd J. Hilberath „geht es in der Nachkonzilszeit nicht zuletzt darum, wem die Interpretationsmacht zukommt.“ 772014 hat sich Thomas Meckel in seiner Würzburger Habilitationsschrift daher noch einmal ausführlich mit dem Verhältnis von „Konzil und Codex“ beschäftigt. 78
Die vorliegende Arbeit verfolgt kein rechtsoder kirchenpolitisches Ziel. Eine mit Verweis auf das II. Vatikanum vom Wortlaut eines kirchlichen Gesetzes absehende Auslegung muss gleichwohl als unzulässig zurückgewiesen werden. 79Sie trifft auch nicht das Selbstverständnis des Gesetzgebers. Schließlich trägt der CIC/1983 nach Papst Johannes Paul II. sowohl inhaltlich wie auch aufgrund seiner Entstehung den Geist des II. Vatikanischen Konzils 80: Der Codex müsse als Versuch des Gesetzgebers verstanden werden, die konziliare Ekklesiologie in eine rechtliche Sprache zu übersetzen. 81Er sei insofern die „Vervollständigung“ der Lehren des Konzils. 82Als Ergebnis „langer, geduldiger und sorgfältiger Arbeit […] stellt er einen maßgeblichen Wegweiser für die Anwendung des Zweiten Vatikanischen Konzils dar“ 83und könne sogar als „letztes Konzilsdokument“ bezeichnet werden. 84Damit aber ist klar: Nicht die Codex ist im Licht des II. Vatikanums zu interpretieren, sondern es gilt umgekehrt: „Der CIC macht deutlich, wie der Gesetzgeber die Konzilstexte versteht und verstanden wissen will.“ 85Gegen den klaren, in Text und Kontext erwogenen Wortlaut eines Gesetzes kann eine vermeintlich „konzilsnahe“ oder „konzilskonforme“ Interpretation nicht durchdringen. „Das Konzil kann kein Rettungsanker gegen inakzeptabel erscheinendes positives Recht sein.“ 86Man kann dies bedauern und die gesetzlichen Interpretationsregeln, insbesondere den c. 17, mit guten Gründen „als positivistisch, voluntaristisch, statisch, nicht-hermeneutisch oder anachronistisch kritisieren“ 87. Der kirchliche Gesetzgeber hat sie im CIC/1983 gleichwohl „erneut ausdrücklich bekräftigt“ 88und den/die Interpretierenden damit gesetzlich gebunden. 89Der c. 17 CIC entsprechende c. 1499 CCEO bestätigt diese methodologische Entscheidung des Gesetzgebers im Gesetzbuch für die katholischen Ostkirchen, das nach Papst Johannes Paul II. wie der CIC als eine Ergänzung der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils anzusehen ist. 90
Die lege artis durchgeführte Auslegung kirchlicher Gesetze kann „zu erstaunlichen, gelegentlich auch erschreckenden Ergebnissen“ 91führen. Dessen ungeachtet ist zwischen Auslegung und Kritik des Gesetzestextes zu unterscheiden: „Die beiden Fragen, was gilt und was gelten sollte, sind auseinanderzuhalten und dürfen nicht ineinsgesetzt werden.“ 92Da sich die Kirche auch in ihrer rechtlichen Ordnungsgestalt verwirklicht, dürfen Gläubige „nicht durch ein idealisierend bzw. harmonisierend weichgezeichnetes Bild der katholischen Kirche getäuscht werden. […] Mit aller Nüchternheit die Rechtslage zu klären, bedeutet nicht, sich zu ihrem Apologeten zu machen.“ 93
1MAIER, Christ, 79. Denn: „Während früher die Tendenz des kirchlichen Lehramtes nicht selten dahin ging, die Mitarbeit der Christen in den modernen verfassungsstaatlichen Institutionen ausschließlich oder doch vorwiegend im Hinblick auf Erhaltung und Festigung der öffentlichen Stellung der Kirche zu betrachten, ihr aber keinen Eigenwert zuzuerkennen, nimmt das Konzil das Politische in einer neuen Weise ernst und stellt es den Christen als Aufgabe vor Augen.“ (ebd., 69.).
2Ebd., 80.
3PAPST BENEDIKT XVI., Ansprache v. 19. Okt. 2006, 9.
4Vgl. PAPST FRANZISKUS, Ansprache v. 30. April 2015, 8: „Se i cristiani si disimpegnassero dall’impegno diretto nella politica, sarebbe tradire la missione dei fedeli laici, chiamati ad essere sale e luce nel mondo anche attraverso questa modalità di presenza.“
5Vgl. PAPST JOHANNES PAUL II., ApKonst „Sacra disciplinae leges“, XII sowie DERS., ApKonst „Sacri canones“ v. 18. Okt. 1990, 1038, dort ohne Verweis auf LG und GS, dafür mit dem Zusatz, durch den CCEO werde die kanonische Ordnung der Kirche schließlich vollendet. Vgl. Lederhilger, Kirchenrecht, 249.
6Der Zusatz „CIC“ wird im Folgenden nur verwendet, wenn er zur Unterscheidung von Canones aus CIC und CCEO erforderlich ist. Canones-Angaben ohne Zusatz beziehen sich also immer auf den CIC/1983.
7Vgl. KKK-Kompendium, n. 519: „Die gläubigen Laien greifen direkt in das politische und gesellschaftliche Leben ein, indem sie die irdischen Bereiche mit christlichem Geist durchdringen und als echte Zeugen des Evangeliums und als Diener des Friedens und der Gerechtigkeit mit allen zusammenarbeiten.“
8Vgl. C. DOCFID, Nota doctrinalis v. 24. Feb. 2002, in: AAS 96 (2004) 359–370. Damit wollte die Kongregation nach eigener Auskunft „einige dem christlichen Gewissen eigene Prinzipien in Erinnerung rufen, die den sozialen und politischen Einsatz der Katholiken in den demokratischen Gesellschaften inspirieren“ (ebd., n. 1, 360f.; dt.: VAS 158, 7).
9Ebd., n. 1, 361; dt.: VAS 158, 7.
10Ebd., n. 6, 367; dt.: VAS 158, 15.
11LEHMANN, Stellungnahme, o. S.
12So z. B. 2004 im Vorfeld der Präsidentschaftswahl in den USA, als der Bischof von Colorado Springs, Michael J. Sheridan, in einem Pastoralbrief vom 1. Mai 2004 versuchte, das Gewissen katholischer Wähler(innen) und Politiker(innen) hinsichtlich gesetzlicher Regelungen zur Abtreibung, embryonalen Stammzellforschung und zu homosexuellen Lebenspartnerschaften zu schärfen. Anlass hierfür war die v. a. in der Abtreibungsfrage von der kirchlichen Lehre abweichende Haltung des katholischen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, John Kerry. Für Aufsehen sorgte im Umfeld der Lateinamerika-Reise Papst Benedikts XVI. 2007 die Behauptung bzw. Androhung der Exkommunikation von Politikern des Lokalparlaments von Mexiko-Stadt, die am 24. April 2007 Abtreibung im Hauptstadt-Distrikt weitgehend straffrei gestellt hatten. Der Papst billigte diese restriktive Reaktion des mexikanischen Episkopats, insbesondere des Erzbischofs von Mexiko-Stadt: „Die Exkommunikation ist nicht etwas Willkürliches, sondern vom Codex […] vorgesehen. Es steht also einfach im kanonischen Recht, daß die Tötung eines unschuldigen Kindes unvereinbar ist mit dem Gang zur Kommunion, wo man den Leib Christi empfängt.“ (PAPST BENEDIKT XVI., Interview v. 9. Mai 2007, 6). Ein ähnlicher Konflikt ereignete sich Anfang Juni 2007 in Australien: Im Vorfeld der Verabschiedung eines Gesetzes zur Freigabe des therapeutischen Klonens im australischen Bundesstaat New South Wales hatte der damalige Erzbischof von Sydney, George Kardinal Pell, den Politikern wiederholt geraten, sich die Folgen ihrer Beschlüsse klar zu machen. In den Medien wurde dies als Hinweis auf eine mögliche Exkommunikation verstanden (vgl. hierzu PRIVILEGES COMMITTEE, Report, 3–7). Auch Erzbischof Barry Hickey von Perth hatte gegenüber einer Zeitung erklärt: „Catholics who vote for the cloning of embryos destined for destruction are acting against the teaching of the Church on a very serious matter and they should in conscience not vote that way, but if they do in conscience they should not go to communion.“ Diese als „Drohung“ gegen katholische Politiker aufgefasste Aussage wurde Gegenstand einer offiziellen Ermittlung des Westaustralischen Parlaments gegen den Erzbischof (vgl. AA.VV., MPs, o. S.). – Am 13. Mai 2009 veröffentlichte die Polnische Bischofskonferenz unter dem Titel „Der Wahrheit über Ehe und Familie dienen“ ein 100 Seiten starkes Dokument, in dem sie die kirchliche Lehre über Ehe und Familie, Fortpflanzung und Abtreibung zusammenfasst und darlegt, welche Pflichten sich daraus für die Gesellschaft ergeben (vgl. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Służyć prawdzie). Mediale Aufmerksamkeit erhielt das Dokument v. a. wegen seiner Warnung, katholische Politiker zögen sich die Tatstrafe der Exkommunikation zu, wenn sie öffentlich für Abtreibung einträten (vgl. z. B. CRAINE/ BAKLINSKI, Polish Bishops, o. S.).
Читать дальше