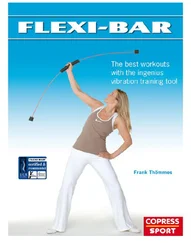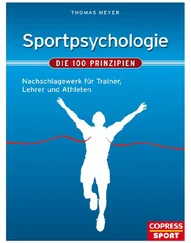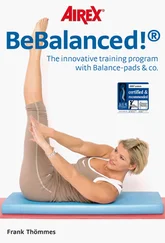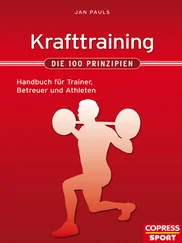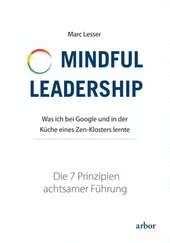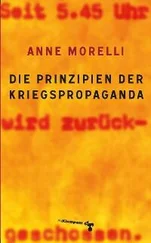| 9 |
|
Doping |
|
|
Die Grenze zwischen der erlaubten und unerlaubten Verabreichung von Präparaten ist klein. |
Das Internationale Olympische Komitee definiert »Doping« als »die beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verwendung von Substanzen aus verbotenen Wirkstoffgruppen und die Anwendung verbotener Methoden entsprechend der aktuellen Dopingliste«. Der Fußball wird im Bereich des professionellen Sports durch Dopingtests überprüft. Ausschlaggebend ist der nicht erlaubte Gebrauch von Substanzen, die auf der Dopingliste der WADA (World Anti Doping Agency) stehen.
Dopingmittel können zur Leistungssteigerung in jeglicher Form führen, abhängig von der Sportart und dem Leistungskriterium. Im Jahre 2009 wurden 32 000 Dopingproben bei Profifußballern genommen, von denen 0,3 Prozent positiv waren. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich höher. Immer wieder werden die Stimmen von Akteuren wie Trainern oder Spielern laut, die von früheren Zeiten berichten, was früher an Dopingmitteln genommen wurde. Die Grenze zwischen Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminpräparaten oder Doping war wesentlich unklarer. Heute werden den Spielern eine Vielzahl von Präparaten verabreicht, die alle nicht auf der Dopingliste stehen oder mit medizinisch begründeten Ausnahmegenehmigungen verabreicht werden dürfen.
Doping ist vor allem im Breitensport ein Problem, da hier keine Tests durchgeführt werden. Fußball ist weniger betroffen als die rein ausdauerorientierten Sportarten wie Radfahren, Schwimmen und Skilanglauf. Vom Doping ist neben der ethischen Komponente des Fair Plays die Gesundheit betroffen, da die Langzeitwirkungen von Dopingpräparaten nicht erforscht sind und jeder Sportler ein hohes individuelles Risiko eingeht.
VERWEISE:
 Fair Play ( 5)
Fair Play ( 5)
 Vorbild ( 1)
Vorbild ( 1)
 Gesundheit ( 86)
Gesundheit ( 86)
 Konzentration ( 25)
Konzentration ( 25)
 Regeneration ( 92)
Regeneration ( 92)
| 10 |
|
Krise |
|
|
Krisen sind Chancen zur Verbesserung der Situation. |
Eine »Krise« ist eine problematische, häufig mit einem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation mit einer massiven Störung des Systems. Im Fußball finden sportliche Krisen regelmäßig statt, und die meisten enden mit der Trainerentlassung. Die Steigerungsform einer Krise wäre die Katastrophe, was sich für einen Fußballverein häufig mit der Situation des Abstiegs oder der Insolvenz einstellt. Aktueller Anlass für eine Krise sind ausbleibende sportliche Erfolge und die verbundene, sich verschlechternde Tabellenplatzsituation.
Eine Krise ist häufig zeitlich begrenzt, geht im Fußball sehr zulasten des Trainers. In Krisensituationen fehlt es häufig an den entsprechenden Analysefähigkeiten der dahinterliegenden psychologischen Situation, die komplex sein kann. Trainerentlassungen bringen meist nicht den gewünschten Erfolg, sondern zeigen nur kurzfristige Wirkung.
Selten sind die ausschlaggebenden Gründe rein fußballspezifischer Natur. Es stecken psychologische Faktoren dahinter, die es verhindern, dass eine entsprechende Leistung abgeliefert werden kann. Oft liegen die Probleme im Bereich der Bedürfnisse der Spieler, die nicht ausreichend befriedigt werden.
Die charakteristischen Kennzeichen einer Krise sind die dringende Notwendigkeit von Entscheidungen, das Gefühl der Bedrohung. Dies geht meist einher mit einem Anstieg an Unsicherheit und dem Zeitdruck. Die Zukunft wird als bedrohlich empfunden. Wenn noch emotionale Komponenten wie Wut oder Verzweiflung aufkommen, ist die Trainerentlassung meist nicht mehr fern.
Im Fußball spielen hier die verschiedenen Parteien wie Spieler, Vereinsverantwortliche, Fans oder die Presse eine wichtige Rolle und können die Krisensituation verschärfen, sodass es zu unüberlegten Handlungen kommt. Kritische Situationen sind selten vorhersehbar.
VERWEISE:
 Trainer ( 63)
Trainer ( 63)
 Krisenmanagement ( 71)
Krisenmanagement ( 71)
 Trainerentlassung ( 65)
Trainerentlassung ( 65)
 Fans ( 6)
Fans ( 6)
 Medien ( 2)
Medien ( 2)
| 11 |
|
Public Viewing |
|
|
Die Fußball WM 2006 in Deutschland war die Geburtsstunde des Public Viewing. |
Wenn große Menschengruppen außerhalb eines Stadions zusammenkommen, um dem Fußballspiel auf Großbildleinwänden beizuwohnen, spricht man seit der WM 2006 im deutschsprachigen Gebrauch von »Public Viewing«. Hintergrund dieser deutschen Erfindung war die zu geringe Anzahl von Eintrittskarten für die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland, die im freien Verkauf für Fans zugänglich gewesen ist. Das Organisationskomitee der WM intervenierte daraufhin bei der FIFA und bei dem Sportrechtevermarkter Infront. Nach langen Verhandlungen wurde der Weg freigemacht, die Liveübertragungen der WM-Spiele kostenlos auf Großbildleinwänden außerhalb der Stadien zu zeigen, was von deutschen Städten und Gemeinden zahlreich genutzt wurde.
Einzige Einschränkung für die (lizenz-)kostenfreie Übertragung war, dass diese nicht durch Sponsoren finanziert wurde und somit nicht kommerziell war. Weitere Bedingung für die kostenfreie Nutzung der Lizenzrechte war die entgeltfreie Nutzung der Übertragung. Sofern Eintritt erhoben wurde, mussten Lizenzgebühren entrichtet werden. Es durften nur ausschließlich lokale oder regionale Sponsoren aktiv werden, die nicht in Konkurrenz zu FIFA-Sponsoren standen. Die einzige Ausnahme blieb das Ausschenken von deutschem Bier, obwohl eine internationale Brauerei FIFA-Sponsor war.
Beim Public Viewing handelt es sich um eine identitätsstiftende Maßnahme, die eine neue Form der Anteilnahme an Großereignissen möglich macht. Bisher war das gemeinsame Erleben von simultan entstehenden Emotionen wie Freude nur Stadionbesuchern vorbehalten. Technisch war das Public Viewing durch die Entwicklung von Großbildleinwänden und Plasmafernsehern möglich geworden. Die Resonanz und Akzeptanz dieser neuen Art von Fankultur überraschte alle Verantwortlichen. Hierbei handelt es sich nicht um Fans im engeren Sinne, vielmehr um eine Art von Fankultur für viele Menschen, die ereignisbezogen und emotional reagieren.

Geteilte Freude ist doppelte Freude: die WM 2006 als Beginn einer neuen Fanbegeisterung.
Public Viewing ist beim Deutschen Patentund Markenamt als Wort-/Bildmarke eines Unternehmens für die Vermietung von Großbildleinwänden geschützt. Als Wortmarke ist der Begriff weiterhin für jeden nutzbar und seit 2007 im Duden gelistet.
Читать дальше
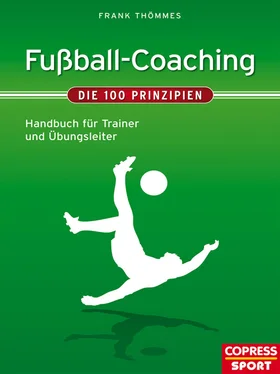
 Fair Play ( 5)
Fair Play ( 5)