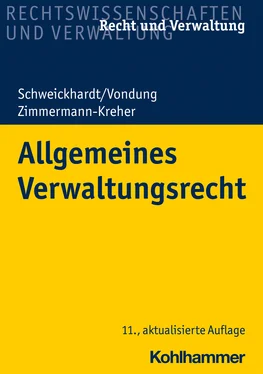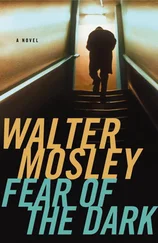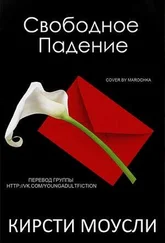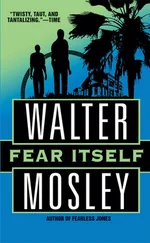Beispiel:Die Gemeinde betreibt ihr Wasserwerk in privatrechtlicher Organisationsform und regelt (bei dieser Organisationsform dann zwingend) das Benutzungsverhältnis privatrechtlich (Rn. 53).
Abwandlung:Die Gemeinde betreibt ihr Wasserwerk in eigener Regie (öffentlich-rechtliche Organisationsform). Hier kann sie das Benutzungsverhältnis öffentlich-rechtlich (Satzung) oder privatrechtlich (AGB) regeln.
17Da der Staat hier die Möglichkeit hat, öffentliche Aufgaben auch in privatrechtlicher Form auszuführen, soll er sich durch Wahl einer privatrechtlichen Organisationsform bzw. eines privatrechtlichen Benutzungsverhältnisses seiner öffentlich-rechtlichen Verpflichtung nicht entziehen können. Deswegen ist allgemein anerkannt, dass die Verwaltung bei der Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben in der Form des Privatrechts ihren öffentlich-rechtlichen Bindungen, also insbesondere der Grundrechtsbindung, unterworfen ist (BGHZ 52, 325, 327; 91, 84, 96 f.; Maurer/Waldhoff, AVR, § 3 Rn. 26 ff. m. w. N.).
Beispiel:Städtische Straßenbahn AG muss bei der Tarifgestaltung den Gleichheitssatz (Art. 3 I GG) beachten.
3.Unterscheidung nach Wirkung für den Bürger
Die Unterscheidung nach den Rechtswirkungen der Verwaltungsmittel für den Bürger führt zur Unterscheidung von Eingriffs- und Leistungsverwaltung.
18 Eingriffsverwaltungliegt vor, wenn die Verwaltung in die Rechtsposition eines Bürgers eingreift, ihm also Verpflichtungen und Belastungen auferlegt.
Beispiele:Abbruchverfügung nach § 65 S. 1 LBO, Beschlagnahme einer Wohnung nach § 38 I Nr. 1 PolG.
Leistungsverwaltungist dagegen anzunehmen, wenn sie dem Bürger Leistungen oder sonstige Vergünstigungen gewährt.
Beispiele:Sozialhilfe, Subventionen, Erteilung einer Baugenehmigung.
Dieselbe Verwaltungsmaßnahme kann sowohl belastend wie auch begünstigend wirken. Ein Bürger kann durch eine Maßnahme belastet, ein anderer begünstigt werden.
Beispiel:Sperrzeitverlängerung zu Lasten des Gastwirts, aber zugunsten des in seiner Nachtruhe gestörten Nachbarn.
Eine Maßnahme kann auch teils begünstigende, teils belastende Wirkung gegenüber demselben Bürger haben.
Beispiel:Eine begünstigende Genehmigung wird mit einer belastenden Auflage verbunden.
Die Unterscheidung ist insbesondere bedeutsam für die Frage, ob die Verwaltung für ihr Handeln eine gesetzliche Grundlage benötigt (Vorbehalt des Gesetzes; näher hierzu 155 ff.).
C.Träger öffentlicher Verwaltung
19Der Staat – also Bund und Länder – kann die Verwaltungsaufgabe durch eigene Behörden erfüllen. In diesem Fall spricht man von unmittelbarer Staatsverwaltung.Der Staat kann die Verwaltungsaufgaben aber auch auf rechtsfähige Verwaltungseinheiten übertragen, nämlich Körperschaften, Anstalten und Stiftungen. Dann spricht man von mittelbarer Staatsverwaltung.
I.Unmittelbare Staatsverwaltung
20 Bundund Ländersind die ursprünglichen Verwaltungsträger. Als juristische Personen sind sie rechtsfähig und können so Träger von Rechten und Pflichten sein. Die unmittelbare Staatsverwaltung ist die Verwaltung durch staatliche Behörden. Entsprechend der föderativen Struktur der Bundesrepublik gliedern sich diese in Bundes- und Landesbehörden.
Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung staatlicher Aufgaben ist nach Art. 30 GG Sache der Länder. Der Vollzug von Bundesgesetzenerfolgt daher grundsätzlich durch die Länder mit Landesbehörden als eigene Angelegenheit gem. Art. 83, 84 GG. Ausnahmsweise handeln die Länder im Auftrag des Bundes gem. Art. 85 GG (z. B. Verwaltung der Bundesautobahnen und Bundesstraßen, vgl. Art. 90 GG) oder der Bund selbst durch bundeseigene Behörden oder bundeseigene Verwaltungsträger gem. Art. 86 ff. GG (z. B. Bundeswehrverwaltung gem. Art. 87b GG).
Der Vollzug der Landesgesetzeist ausschließlich Sache der Länder (BVerfGE 21, 312, 325).
II.Mittelbare Staatsverwaltung
21Der Staat muss die Aufgaben nicht stets durch eigene Bundes- und Landesbehörden erfüllen, sondern kann sie auf rechtlich selbstständige Organisationen (juristische Personen) übertragen: auf Körperschaften , Anstalten und Stiftungen(sog. mittelbare Staatsverwaltung, vgl. Maurer/Waldhoff, AVR, § 23 Rn. 1 ff.). Hinzu kommen noch die Beliehenen als eigene Rechtsfigur.
1.Körperschaften des öffentlichen Rechts
22Körperschaften des öffentlichen Rechts sind mitgliedschaftlich verfasste, aber unabhängig vom Wechsel der Mitglieder bestehende Organisationen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.
Beispiel:Gemeinden, Gemeindeverbände (wie Landkreise), Universitäten, IHK, Rechtsanwaltskammern, kommunale Zweckverbände (z. B. Abwasserzweckverbände).
Eine Sonderstellung nehmen die nach Art. 28 I und II GG verfassungsrechtlich garantierten Gemeinden und (Land)Kreise ein. Sie sind Gebietskörperschaften, bei denen die Mitgliedschaft aus dem Wohnsitz in einem bestimmten Gebiet (Gemeinde, Kreis) folgt. Der Bestand der Körperschaft ist unabhängig vom Wechsel der Mitglieder (Gemeinde-/Kreiseinwohner).
2.Anstalten des öffentlichen Rechts
23Die Anstalt ist eine organisatorische Zusammenfassung von Verwaltungsbediensteten und Sachmitteln (Gebäude, technische Ausstattung). Sie ist organisatorisch verselbstständigt und hat bestimmte Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen, insbesondere Leistungen zu erbringen (Maurer/Waldhoff, AVR, § 23 Rn. 48 ff.). Anstalten sind im Gegensatz zu den Körperschaften des öffentlichen Rechts nicht verbandsmäßig organisiert. Sie haben i. d. R. Benutzer, und keine Mitglieder.
Beispiel:Öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalten, Sparkassen, Studentenwerke, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA).
24Von den rechtsfähigen sind die nicht rechtsfähigenAnstalten zu unterscheiden. Die nicht rechtsfähige Anstalt ist nur organisatorisch selbstständig; rechtlich ist sie dagegen unselbstständiger Teil eines anderen Verwaltungsträgers.
Beispiel:Friedhöfe, kommunale Schulen, Schwimmbäder, Stadtwerke, Krankenhäuser (zum Teil können diese Einrichtungen auch in privatrechtlicher Form als sog. Eigengesellschaften in Form von Aktiengesellschaften oder GmbHs geführt werden, z. B. Stadtwerke GmbH).
3.Stiftungen des öffentlichen Rechts
25Stiftungen des öffentlichen Rechts sind rechtsfähige Organisationen, denen ein Stifter Vermögenswerte (Kapital oder Sachwerte) zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe übertragen hat. Stiftungen haben weder Mitglieder noch Benutzer; sie haben nur Nutznießer. Sie werden durch einen staatlichen Hoheitsakt errichtet.
Beispiele:Stiftung preußischer Kulturbesitz mit dem Zweck, die früher preußischen Kulturgüter zu bewahren, zu pflegen und zu ergänzen (BGBl. I 1957 S. 841), die Stiftung Hilfswerk für behinderte Kinder (BGBl. I 1976 S. 1876), Bundeskanzler-Willi-Brandt-Stiftung (BGBl. I 1994 S. 3138), Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BGBl. I 1998 S. 1226), Stiftung „Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg“ (GBl. 1991, 498, 595).
26Grundsätzlich sind die oben genannten juristischen Personen des öffentlichen Rechts Träger der öffentlichen Verwaltung. Der Staat hat aber auch die Möglichkeit, hoheitliche Befugnisse auf Beliehene zu übertragen. Beliehene sind Privatpersonen (natürliche Personen oder juristische Personen des Privatrechts), auf die durch Hoheitsakt (Gesetz, VA) in begrenztem Umfang hoheitliche Befugnisse übertragen werden. Insoweit sind sie in die mittelbare Staatsverwaltung einbezogen. Beliehene sind, soweit ihr hoheitlicher Kompetenzbereich reicht, Verwaltungsträger. Beliehene handelngrundsätzlich im eigenen Namen.In einem Prozess sind sie selbst Partei; verwaltungsgerichtliche Klagen sind gegen sie zu richten (Detterbeck, AVR, Rn. 193).
Читать дальше