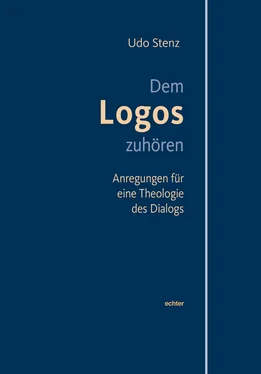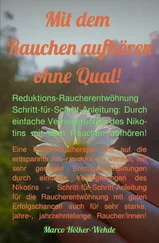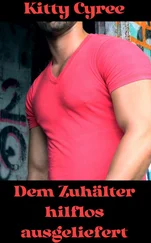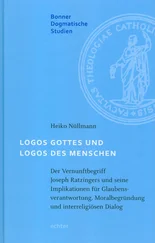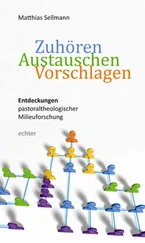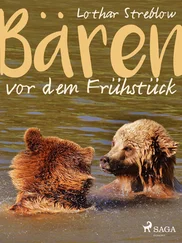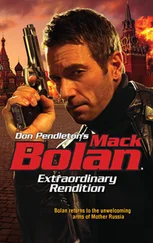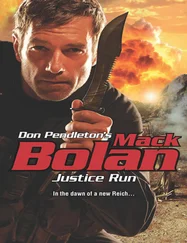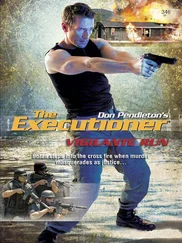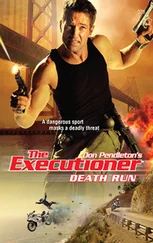Im dritten Kapitel wird schließlich versucht, aus den philosophischen und theologischen Überlegungen ein Verständnis von Dialog zu entwickeln, das den Anforderungen der heutigen Pluralität der religiösen und nichtreligiösen Bekenntnisse und Nicht-Bekenntnisse gerecht wird. Die Überlegungen laufen auf eine Differenzierung zwischen zwei Herangehensweisen hinaus, die in einem Verständnis von Dialog möglich sind. Es kann einerseits darum gehen, dass die Gesprächspartner versuchen, sich im Dialog zu definieren, d. h. voneinander abzugrenzen oder sich gar in eine abgestufte Reihenfolge zu bringen. Neben diesem eher wettbewerblichen und deshalb als kompetitiv bezeichneten Verständnis wird ein relationales Verständnis vorgeschlagen. In diesem geht es darum herauszufinden, welche Beziehung zwischen den Dialogpartnern bestehen kann, wie sie aufeinander einwirken und voneinander lernen. Je weniger diese Frage von einer wettbewerblichen Sicht gekennzeichnet ist, desto geringer wird die Gefahr, die Wahrheit aufzugeben oder zu relativieren. Wenn auch beide Sichtweisen im Verhältnis zwischen den Religionen ihre Berechtigung haben – zumal das römische Lehramt beide Sichtweisen beleuchtet – so wird sich zeigen, dass innerhalb der Zielorientierung im Dialog ein relationales Verständnis weiter führen kann als ein kompetitives. Insbesondere im Bereich der Theologie der Religionen kann sich ein relationales Verständnis verdient machen, ebenso wie für die Herausforderungen, die sich für eine zahlenmäßig kleiner werdende Kirche im Kontext religiöser und weltanschaulicher Pluralität stellen.
Im Übrigen sind Methodologie und Auswahl des Stoffes persönlich geprägt. Im Lesen der zuvor zitieren Aussage Kardinal Ratzingers, der das Titelzitat entnommen ist, kam mir spontan die Frage, wie die Chancen aussehen, dass der geäußerte Wunsch sich erfüllt. Diese Frage stellte sich mir vor dem Hintergrund meiner eigenen missiologischen und theologischen Studien in Rom, die mich in den vergangenen Jahren mit Personen, Gedanken und Autoren in Verbindung brachten, die sich als hilfreich für die Fragestellung erweisen könnten. Vor diesem Hintergrund gestaltete sich der methodische Rahmen in der Weise, nicht eine vollständige Theologie des Dialogs zu erarbeiten, sondern Anregungen aufzuzeigen. Damit ist gleichzeitig gesagt, dass es nicht darum geht, Gedankengänge eines Autors oder mehrerer Autoren in ihrer Vollständigkeit zu analysieren und zu valutieren, sondern diese aufzugreifen und Möglichkeiten zu suchen, sie für weiteres Nachdenken fruchtbar zu machen. Das hat dazu geführt, dass in dieser Studie zahlreiche Autoren zu Wort kommen und in eine Verbindung gebracht werden, die dazu anregen kann, die Grundlagen und Möglichkeiten des Dialogs, insbesondere des interreligiösen und interkulturellen, weiter zu vertiefen.
Jedes Kapitel beginnt mit einer skizzenhaften Darstellung des Hintergrundes, vor dem sich die dann folgenden Überlegungen verstehen und von dem sie angeregt werden. Damit ist nicht die vollständige Darstellung einer Wirklichkeit beabsichtigt, die ohnehin zu komplex erscheint. Es sollen vielmehr die Motivation der Gedankengänge anschaulich gemacht und der Einstieg aus der Zeit und dem Kontext heraus gefunden werden.
Bei all dem wird keine abgeschlossene Systematik einer Theologie des Dialogs versucht, vielmehr geht es um Anregungen, mögliche Wege des Dialogs weiter zu beschreiten.
1„Der Dialog unterbricht die Gewalt“, schreibt W. STEGMAIER, Heimsuchung. Das Dialogische in der Philosophie des 20. Jahrhunderts , in: FÜRST, G. (HG.), Dialog als Selbstvollzug der Kirche? Quaestiones disputatae 166, Freiburg – Basel – Wien 1996, 9-29, hier: 9.
2Vgl. das Eröffnungsreferat von Bischof KARL LEHMANN bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda vom 19. September 1994, Vom Dialog als Wahrheitsfindung in der Kirche heute . Zit. nach: SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ (HG.), Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz 17, Bonn 1994, 5: „‚Dialog’ ist auf neue Weise zum Signal für die Diagnose und Therapie in der heutigen Gesellschaft geworden. Überall wird in umfassender Weise der Dialog als Form des Umgangs miteinander und der Kommunikation gefordert. Dies gilt in besonderer Weise für die Kirche. Hier kann es […] programmatisch heißen: ‚Dialog statt Dialogverweigerung. Wie in der Kirche miteinander umgehen?’“
3F. KÖNIG – J. DUPUIS, Unterwegs zu einem Dialog der Religionen , in: Stimmen der Zeit 226 (2008), 232-244, hier: 236.
4Vgl. Lumen gentium 1.
5Vgl. H. J. POTTMEYER, Dialog und Wahrheit. Wie die Kirche ihre Wahrheit findet und lebt , in: SCHAVAN, A. (HG.), Dialog statt Dialogverweigerung. Impulse für eine zukunftsfähige Kirche , Kevelaer 21995, 90–96, hier: 94.
6Allerdings werden die Begriffe Diskurs und Dialog sehr häufig gerade im kirchlichen Sprachgebrauch synonym verwendet, was auch W. BEINERT, Wenn Mutter Kirche ihren Pass verliert. Oder: Ekklesiologie des Dialogs , in: ThPQ 146 (1998), 349-356, hier: 351, feststellt.
7Vgl. W. LÖSER, Art. „Dialog“, in: W. BEINERT (HG.), Lexikon der katholischen Dogmatik , Freiburg – Basel – Wien 1997, 83-86, hier: 84.
8CASSIODOR, Expositio in Psalmum 95 (94), Vers 1 , PL 70, 671.
9J. RATZINGER, Der Dialog der Religionen und das jüdisch-christliche Verhältnis ; Erstveröffentlichung: Internationale katholische Zeitschrift Communio 26 (1997), 419-429; zit. nach: J. RATZINGER, Die Vielfalt der Religionen und der Eine Bund , Urfelder Reihe 1, Hagen 42005, 93–121, hier: 120-121.
10NIKOLAUS VON KUES, Über den Frieden im Glauben – De pace fidei , zit. nach der Ausgabe L. MOHLER (HG.), Meiner Philosophische Bibliothek 223, Leipzig 1943.
11 Ebd ., 96.
12Zum Stand der Diskussion vgl. R. HAUBST (HG.), Der Friede unter den Religionen nach Nikolaus von Kues. Akten des Symposions in Trier vom 13.-15. Oktober 1982 , Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 16, Trier 1984, darin: J. STALLMACH, Einheit der Religion – Friede unter den Religionen. Zum Ziel der Gedankenführung im Dialog “Der Friede im Glauben”, 61-75, hier: 63.
13So: W. DUPRÉ, Menschsein und Mensch als Wahrheit im Werden. Einige Bemerkungen zum Problem der Religion bei Nikolaus von Kues , in R. HAUBST (HG.), Der Friede unter den Religionen , 313-324, hier: 320.
14Vgl. J. STALLMACH, Einheit der Religion , 72-73.
15Vgl. W. A. EULER, Einheit der Religionen – Friede unter den Menschen. Begegnung mit nichtchristlichen Religionen bei Ramon Llull und Nikolaus von Kues , in: C. LOHR – E. COLOMER (HG.), Anstöße zu einem Dialog der Religionen. Thomas von Aquin – Ramon Llull – Nikolaus von Kues , Freiburg 1997, 71–91, hier: 85-86.
16Die Philosophie ist nach PETRUS DAMIANI, De divina omnipotentia 5,621, die „ancilla theologiae“.
1. K A P I T E L
PHILOSOPHISCHE ANNÄHERUNGEN — WAHRHEIT IM DIALOG
Vorbemerkung: Der Umbruch des Denkens als geistesgeschichtlicher Kontext
Wer sich daran macht zu untersuchen, wie auf philosophische Weise ein „Hinhören auf den Logos “ gehen kann, der wird sich zunächst darüber Gedanken machen, in welche Richtung die philosophische Betrachtung geht, d. h. wo das Denken seinen Ausgang nimmt und wohin es führen soll. Anders gefragt: Wer oder was ist der Agent, der Protagonist der Denkbewegung? Ist es der Denkende, der versucht, ein Gedachtes zu erreichen oder gar zu formen? Oder ist es das Gedachte oder zu Denkende, was nach dem Denkenden greift? Bei diesen Überlegungen mag man auf einen Begriff stoßen, mit dem eine geisteswissenschaftliche Strömung des 20. Jahrhunderts gekennzeichnet wird: den „Umbruch des Denkens“ 1.
Читать дальше