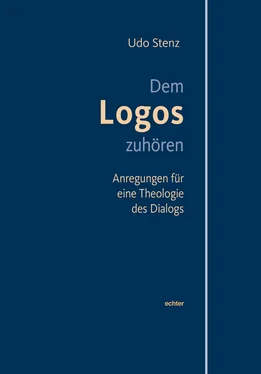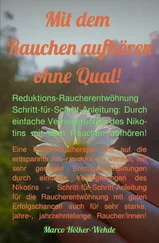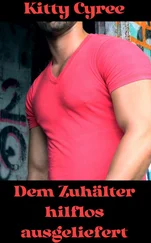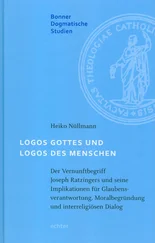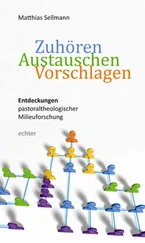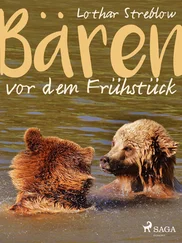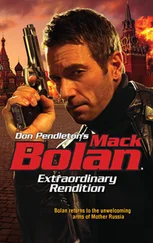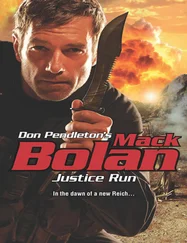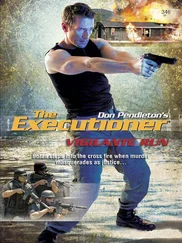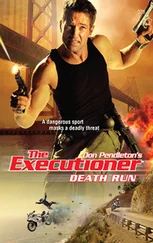2.2.3.2Die Geburt der Kirche aus dem Dialog: Das Pfingstereignis
2.3Für eine dialogische Hermeneutik von Schöpfung und Heilsgeschichte
2.3.1Die Creatio als Eintritt des dreifaltigen Gottes in einen Dialog mit der Creatura
2.3.1.1Schöpfung als Kommunikation des Bundes
2.3.1.2Schöpfung als Anrede
2.3.2Schöpfung und Gnade: Religion in dialogischer Bewegung
2.3.2.1Die Gnade der Schöpfung und die Vielfalt der Religionen
2.3.2.2Die Verehrung der Herrlichkeit als gnadenhafte religiöse Grundstruktur
Zwischenergebnis
3. Kapitel: Kirche, die sich zum Dialog macht – Kompetitive und relationale Perspektiven
Vorbemerkung: Kirche und Dialog in postmoderner Pluralität
Dialogizität der Kirche – Ecclesiam suam
Die Geschichte des Menschen als Geschichte der Pluralität
Begegnung verschiedener Wahrheitsansprüche
Der Relativismus als postmoderne gegenseitige Verhandlung über Wahrheit
3.1Wege des Dialogs
3.1.1Dialog als Diskurs
3.1.2Kompetitiv oder relational? Begegnung als Wettbewerb oder Beziehung
Das kompetitive Argument: Begegnung als Wettbewerb Das relationale Argument:
Begegnung und Bewährung in Beziehung
3.1.3.Diskurs und Dialog – kompetitive und relationale Hermeneutik des Gesprächs
3.2Relational-dialogische Hermeneutik der Einzigkeit Jesu Christi
3.3Die Theologie der Religionen im Licht eines relationalen Verständnisses
3.3.1Linien der Theologie der Religionen
3.3.2Das Christentum in Beziehung statt im Wettbewerb zu den Religionen
Aufbruch „istischer“ Selbstverengungen in der Theologie der Religionen
3.3.3Ein Vorschlag: Kommunikative Religionstheologie
3.4Der kirchliche Auftrag zur interreligiösen Begegnung
3.4.1Die interreligiöse Begegnung als Ort von Wachstum und Heiligungsdienst
3.4.2Der Dialog als Ort der Religionskritik
3.4.3Licht für die Heiden und Herrlichkeit für sein Volk Israel Im Dialog mit Jesus Christus: M. Buber
3.5Kirche auf dem Weg des Dialogs – kompetitiv oder relational?
3.5.1Noch einmal: Ecclesiam suam und das Konzil
3.5.2Verkündigung im Spannungsfeld zwischen Dialog und Mission
3.5.3Johannes Paul II. und die Begegnung von Religionen
3.5.4Kompetitive Klarstellung und relationale Offenheit: Dominus Iesus
3.5.5Dem Logos zuhören: Benedikt XVI.
Zwischenergebnis
Synthese – Perspektiven des Dialogs
Wir sind Gespräch – Romantische Gedanken und ihre Verwirklichung
Der intersubjektive Weg zu Gott: Dialog
Die Differenzierung kompetitiv-relational als hermeneutischer Schlüssel
Dialog und Vollendung
Bibliographie
Zum Geleit
In der Kirche stehen die Zeichen auf Dialog. Die Lebendigkeit des Glaubens und die Vitalität unserer Gemeinden und Gemeinschaften werden in Zukunft nicht zuletzt davon abhängen, wie wir auf allen Ebenen miteinander ins Gespräch kommen und wie wir das Gespräch mit jenen suchen, die scheinbar draußen sind. Die Dialogkultur, die es dabei zu entwickeln und zu verfeinern gilt, ist nicht nur eine bürgerliche Tugend, sondern bedarf auch einer tiefen theologischen Verwurzelung.
Pfarrer Dr. Udo Stenz leistet hierzu mit der vorliegenden Studie einen wertvollen Beitrag. Ihr Roter Faden ist die Einsicht, dass in allen Bereichen rechtes Miteinandersprechen ein achtsames Hören voraussetzt – ein Hören nicht nur aufeinander, sondern vor allem ein Hören auf eine Mitte, auf das Wort Gottes selbst, auf den Logos. Der Autor hat sich auf die Suche gemacht und in aktuellen Denkrichtungen von Philosophie und Theologie die Bestätigung gefunden, dass Gott selbst in einem unter Menschen geführten Dialog zu Wort kommen kann. Als Bischof von Speyer freut es mich ganz besonders, dass auch das Denken der hl. Edith Stein hierbei gewürdigt und rezipiert wird, die in unserem Bistum in Taufe und Firmung Christ wurde und als Lehrerin gewirkt hat.
Aus verschiedenen Ansätzen modelliert Pfarrer Stenz ein Verständnis des Dialogs, bei dem es zuvorderst darum geht, Beziehung lebendig werden zu lassen und zu fördern. Daraus entsteht kein in sich geschlossenes System; die Studie lässt vielmehr Raum, selbst kritisch-kreativ weiterzudenken, und erweist sich dabei als ein hilfreicher Leitfaden für jede Art von Dialog.
Ich kann deshalb nur begrüßen, dass Pfarrer Udo Stenz seine Forschungen und Überlegungen, die durchaus als richtungsweisend und gewinnbringend bezeichnet werden dürfen, hiermit allgemein zugänglich macht.
+ Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer
E I N L E I T U N G
Dialog ist heute in aller Munde
Diese Feststellung kann in einem wörtlichen und in einem übertragenen Sinn verstanden werden. Im wörtlichen Sinne bezeichnet sie die Tatsache, dass der Mensch stets in Kommunikationen lebt, die sehr häufig als Dialog bezeichnet werden. Am ehesten denkt man dabei an das Gespräch mit einem oder mehreren anderen Menschen, das unterschiedliche Grade von Alltäglichkeit, Verbindlichkeit und Ernsthaftigkeit haben kann. Es kommt entweder zu einem Konsens oder zu einem Dissens. Doch auch mit technischen Geräten führt man Dialoge, etwa bei der Bedienung von Computerprogrammen, die sich scheinbar immer wieder in Meldungen der Absichten des Anwenders vergewissern und ihn zu Eingaben oder Mausklicks bewegen. Mittlerweile sind Autowerkstätten dazu übergegangen, die Überprüfung von Fahrzeugen und die Fehlerdiagnose als Dialog zu bezeichnen. Sie werden mit Geräten durchgeführt, die einen Impuls an den Bordcomputer des Fahrzeugs senden, welcher darauf antwortet. Auf literarischem Gebiet steht Dialog für eine literarische Gattung. Eine nicht zu übersehende Zahl von Schriftstellern hat sich über die Jahrhunderte hinweg immer wieder einer verschriftlichten Gesprächsform bedient, um ihre Aussageabsichten darzulegen, indem sie sie anhand von Rede und Gegenrede erarbeitete. Dialog ist des Weiteren ein beliebtes rhetorisches Mittel, um in einer gegenüber einem Monolog lockereren und ansprechenderen Form Gedanken zu entwickeln. Dieser kurze Überblick zeigt, dass das Begriffsverständnis von Dialog sehr vielfältig ist: Dialog ist in aller Munde, jeder führt ihn. Das bedeutet nicht, dass jeder darunter dasselbe versteht oder dass die vielen Dialoge gleich aussehen.
Das große Spektrum, Dialog zu verstehen, fließt ein in die weitere Auslegung der eingangs erhobenen These, Dialog sei in aller Munde. Diese besteht in der Einsicht und der Forderung, dass Dialog stattfinden müsse. Der Mensch kann und darf sich dem Dialog nicht entziehen. Dialog zu führen, dialogisch zu leben: das sind Grundforderungen der Verhaltensweise, an denen niemand so leicht vorbeikommt. Dialogfähigkeit ist ein allenthalben als positiv anerkannter Charakterzug eines Menschen. Das gilt z. B. dann, wenn er Leitungsgewalt ausübt und anderen etwas zu sagen hat. Es geht dabei darum, den anderen zu Wort kommen zu lassen und ihn nicht einseitig zu befehligen. Dahinter steht offenkundig die Einsicht, dass der einzelne Mensch fast immer in mannigfaltigen und wechselseitigen Zusammenhängen steht, die er in unterschiedlichem Maß und Gewicht selbst prägt, die aber ihrerseits auch ihn prägen. Und dahinter steckt auch das Verlangen, dass Menschen einander in diesen Zusammenhängen ohne das begegnen, was im weiteren Sinne als Gewalt bezeichnet werden kann 1. „Dialog“ und das Adjektiv „dialogisch“ kennzeichnen eine Kultur und eine Geisteshaltung, die die Gemeinschaft, die soziale Offenheit gegenüber einer individuellen Selbstgenügsamkeit hervorhebt.
Читать дальше