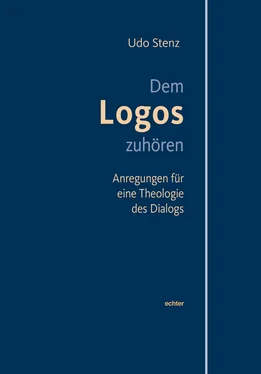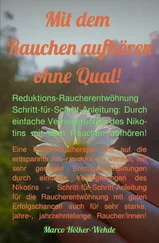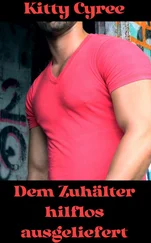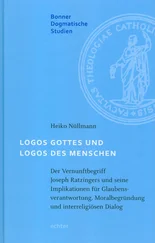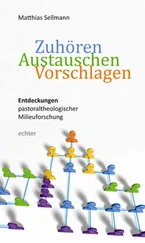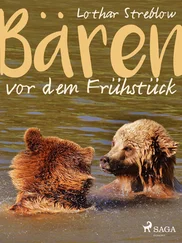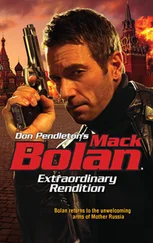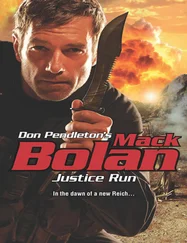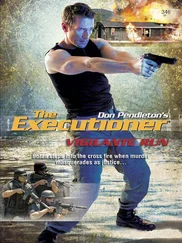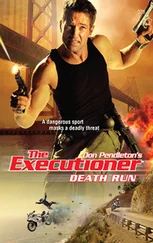Dabei greift er zurück auf Nicolaus Cusanus’ (eigentlich Nikolaus v. Kues, 1401 -1464) Schrift De pace fidei 10(1453). Dieser beschreibt darin eine Art Konzil, das im Himmel um das göttliche Wort, also den Logos herum, stattfindet. Vor ihm versammeln sich die „bedeutsamsten Männer der Welt“ 11, um herauszufinden, wie die eine Wahrheit mit der Verschiedenheit der Religionen und Bräuchen in Zusammenhang gebracht werden könne. Sie hören dem Logos zu, der ihnen verständlich macht, dass die Wahrheit nur eine ist, sich aber aufgrund des freien Willens der Menschen in unterschiedlichen Bräuchen und Religionen ausdrückt. Die Verschiedenheit der Religionen sei aber auf den einen wahren Glauben zurückzuführen, so wie die Weisheit nur eine sei und einen Ursprung habe.
Das Interesse, aus dem Cusanus sich die Mühe macht, in der ihm eigenen dialektischen Art die Spannung zwischen Einheit und Vielfalt theologisch zu erläutern, wird in der Forschung nicht einheitlich gesehen. Zum Teil wird die Ansicht vertreten, der Kardinal habe vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Spannungen im Mittelmeerraum aufzeigen wollen, dass der Friede gerade von den Religionen ausgehen müsse. Zum Teil wird ein religionstheologisches Anliegen bescheinigt, sodass De pace fidei als ausdrückliche Toleranzschrift erscheint 12. In diesem Rahmen wird sie wiederum unterschiedlich gedeutet: Cusanus wird von einigen die Ansicht zugeschrieben, keine Religion könne die ganze Wahrheit besitzen, diese müsse gemeinschaftlich zusammengetragen werden 13. Demgegenüber wird betont, die Weisheit als der Ursprung von allem bilde bereits die Einheit, diese müsse aus den Religionen heraus nur noch gesucht und gefunden werden. Da die Weisheit des Logos nicht verschieden von der einen philosophischen Weisheit sei, könne Cusanus die Zuversicht haben, dass alle zur wahren Religion kämen 14.
Wie auch immer man die Beweggründe des Cusanus deutet: In dem diskutierten Werk geht es nicht darum, Religionen zu ersetzen oder auszutauschen. Sie können nebeneinander bestehen. Wohl aber muss erkundet werden, worin ihr wahrer Kern liegt. Dies geschieht aus dem Logos heraus. Dabei lässt der Kardinal keinen Zweifel daran, dass er monotheistischtrinitarisch und von daher in Bezug auf die Religionen christologisch und christozentrisch denkt 15. Es wird deutlich, dass Cusanus von der Beziehung ausgeht, die sich vom Logos her mit den Anderen ergibt. Wenn der Dialog als Beziehungsgeschehen verstanden wird, kann sich aus De pace fidei in der Tat eine Anleitung zum Dialog ergeben.
Hören auf den Logos auf Erden
Das Hören auf den Logos dürfte sich allerdings in der irdischen Praxis weniger reibungslos gestalten als auf dem cusanischen Himmelskonzil. Was auf dem Hintergrund christlicher Theologie einleuchtet, erscheint in anderen Religionen und Weltanschauungen unmöglich, die den Logos als solchen nicht kennen oder anerkennen. Wenn Ratzinger im Kontext des jüdisch-christlichen Dialogs aber trotzdem den Wunsch zu äußern wagt, dass man nicht nur dem Logos zuhören möge, sondern dies gemeinsam tun solle, also religionsübergreifend, sieht er offenbar hinter dem Horizont des christologischen Bekenntnisses zum Logos weitere Möglichkeiten, dass dieser eine Logos sich verständlich macht. Diese Möglichkeiten sind, christlich verstanden, nicht einfach da, sondern aktuieren sich im Dialog, den die Kirche (und mit ihr die Christenheit) mit der Welt von heute und dabei insbesondere den Religionen führt. Eine wertvolle Hilfestellung bietet dabei der Gedanke, dass die universale Vernunft, die als Logos bezeichnet werden kann, allgemeiner und universaler Anerkennung und Zustimmung fähig ist. Für das Christentum ist diese Vernunft nicht außerhalb der Person Jesu Christi zu denken. Die Frage, wie das Hören auf den Logos möglich sein kann, führt deshalb an einige Problemkreise heran. Wenn der Glaube an den Logos Jesus Christus nicht geteilt wird, so bietet es sich an, das Hören auf den Logos als Akt des Menschen zunächst unabhängig von diesem Glauben zu beschreiben. Man kann versuchen, Anregungen zu finden, wie eine Struktur aussehen kann, in der ein Hinhören auf den Logos möglich ist. Diese Struktur wird sich aus Sicht des Christentums nicht anders realisieren können als im Hinhören auf Jesus Christus. Außerhalb des Bekenntnisses zu Jesus Christus wird sie aus der Sicht anderer Religionen und aus der Sicht nichtreligiöser Weltanschauungen als verbindliches Hinhören angesehen werden, sofern sie auf einem soliden philosophischen Fundament steht. Diesen Fragen soll in der vorliegenden Studie nachgegangen werden.
Aufbau und Methode der vorliegenden Studie
Die Formulierung der Fragestellung gibt im Groben die Gliederung und den methodischen Gang der Überlegungen vor.
Im ersten Kapitel wird der Überlegung nachgegangen, wie menschliche Kommunikation und Dialog aussehen können, damit sich darin ein Drittes, der Logos , zu verstehen gibt. Das Arbeitsgebiet ist hierbei philosophisch. Es geht um Strukturen, die auch ohne die Rückbindung an ein religiöses Bekenntnis einsichtig gemacht werden können. Von der Theologie aus gesehen: Eine Theologie des Dialogs ist umso solider, je mehr sie sich von der Philosophie gleichsam als Magd bedienen und sich von ihr gedankliche Strukturen und Instrumentarien bereitstellen lässt, mit denen sie theologische Inhalte verständlich machen kann 16. Als philosophischer Denkweg bietet sich zunächst die Phänomenologie an. Sie erscheint für theologische Fragestellungen nützlich: Seit ungefähr einem Jahrhundert hat sich eine Religionsphänomenologie etabliert, die versucht, Strukturen religiöser Phänomene aufzuzeigen und von daher Gemeinsamkeiten der Religionen festzustellen. Auf diesen religionsphänomenologischen Ansatz soll indes nicht ausführlich eingegangen werden. Das phänomenologische Interesse richtet sich im vorliegenden Rahmen vielmehr auf die Beziehungen zwischen Menschen ihrer zugrunde liegenden Struktur. Es ist darzulegen, wie das Subjekt zum Anderen gelangt und was auf diesem Weg in der Beziehung zwischen ihnen entstehen und sich ereignen kann. Dialog wird damit phänomenologisch sowohl als intersubjektives Geschehen erschlossen wie auch als Möglichkeit, wahrzunehmen, dass Transzendenz sich immanent zur Sprache bringt. Dabei erweist sich unter anderem ein Blick auf das Dialogische Denken als hilfreich, welches auf dem phänomenologischen Gedankengang aufbaut.
Im zweiten Kapitel wird zunächst der Frage nachgegangen, wie Transzendentes sich in die dialogische Disposition der Subjekte hineingeben kann. Die zuvor aufgezeigten philosophischen Strukturen erweisen sich als geeignet, sowohl in einem allgemein religionswissenschaftlich verstandenen Sinn Heiliges als auch den Logos Jesus Christus zu empfangen. Es wird darauf Wert zu legen sein, dass es dabei nicht um eine Projektion menschlichen Denkens geht, sondern um ein Rufen nach Gott aus der Mitte der Existenz heraus, auf welches das Heilige – Gott – der Logos Antwort gibt, indem er sich auf den Menschen in intersubjektiver Verfasstheit einlässt. Religionswissenschaftlich werden sich deshalb die phänomenologisch begründeten intersubjektiven Strukturen als tragfähig für eine Offenbarung transzendenter Wirklichkeit erweisen. Aus christlicher Sicht wird zu zeigen sein, dass sich die Offenbarung in Jesus Christus auch mit dem philosophischen Instrumentarium der Phänomenologie denken lässt. In diesem Rahmen kommt es darauf an, ob die Mitte christlicher Theologie auch die Mitte eines Dialogs sein kann und darin zur Sprache kommt, dass also Jesus Christus Ausdruck und Ereignis des Dialogs ist. Damit wird die Frage nach dem bestimmten Dialog spannend, in welchen jemand einbezogen ist, dem das Bekenntnis zu Jesus Christus fremd ist. Diese Frage ist die alles entscheidende, denn von ihr hängt ab, ob es einen Dialog der Religionen als gemeinsames Hören auf den Logos geben kann oder nicht. Es wird zu zeigen sein, dass das gemeinsame Hören auf den Logos auch dann möglich ist, wenn es nicht allerseits auf der Basis des ausdrücklichen Bekenntnisses zu Jesus Christus aufliegt. Umgekehrt ausgedrückt: Wer sich je auf einen wirklichen Dialog über die Wahrheit und das Heil einlässt, der kommt unweigerlich in Kontakt mit dem Logos . Innerhalb eines so gedachten dialogischen Beziehungssystems findet die kirchliche Verkündigung Jesu Christi als des ewigen Logos ihren Platz und erweist sich als dessen Mitte. Dabei wird ein Zusammenhang deutlich, der zwischen der eher vertikal zu denkenden Selbstmitteilung Gottes an den Menschen und der eher horizontal zu denkenden intersubjektiven Kommunikation besteht. Gott teilt sich mit und bringt sich in diesem Mitteilen zugleich zwischenmenschlich kommunikativ zur Sprache.
Читать дальше