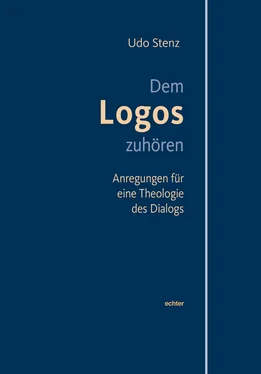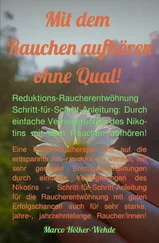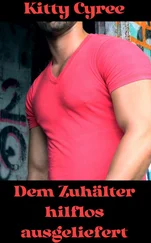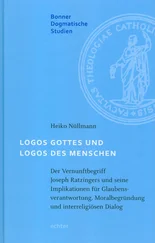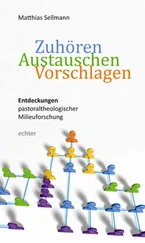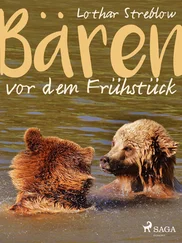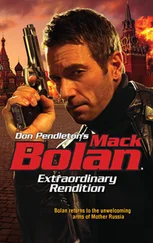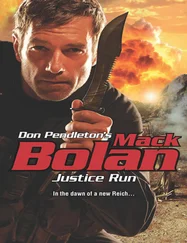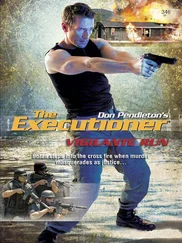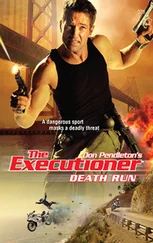Die Erfahrung des Anderen als alter Ego und die Selbsttranszendenz des Ich
Damit zeigt sich, dass auch der Andere im Subjekt und seinen Potentialitäten bereits angelegt ist; der bereits erwähnte Zusammenhang von Systole und Diastole, der sich in der bereits skizzierten husserlschen Monadenlehre zeigt, erweist gerade im Bereich der Intersubjektivität, die Husserl als Teil der Konstitution der Welt versteht, den gesamten Umfang seiner Bedeutung.
Husserl spricht gar von „Paarung“ 162. Vom eigenen Ich aus, d. h. vom Standpunkt der Monade, die das Ich selbst ist, wird der Andere wahrgenommen als eine ebensolche Monade. Das bedeutet aber nicht, dass der Andere als Kopie des Ich selbst wahrgenommen wird. Die phänomenologische Epoché gestattet dies nicht, weil sie ja gerade die Eigenheiten des Ich , die es erlauben würden, es mit einem anderen Ich zu vergleichen, ausklammert. Vielmehr ist die Wahrnehmung des Anderen als alter Ego phänomenologisch geprägt durch appräsentierte Wahrnehmung. Die andere Monade konstituiert sich appräsentativ in der eigenen 163. Das bedeutet: Zusammen mit dem, wie der Andere als Nicht- Ich , das zur Welt gehört, erscheint, erscheint gleichzeitig seine eigene Intentionalität, die mir entzogen ist und über die ich nicht verfügen kann und die daher nie ganz und erfüllend wahrgenommen werden kann 164. „Wir finden bei genauer Analyse wesensmäßig dabei vorliegend ein intentionales Übergreifen“ 165und damit eine Selbsttranszendenz des Ich auf das alter Ego hin. Hier erweist sich die volle intersubjektive Tragweite der oben bereits skizzierte husserlschen Monadenlehre in Abgrenzung zu derjenigen Leibniz’.
Die transzendentale Reduktion auf das primordiale Ich lässt also eine Monade hervortreten, die zum einen der anderen Monade bedarf und zum anderen sich selbst auf die andere Monade hin entwirft. Gleichzeitig aber überschreitet sie sich selbst und gibt sich in ein Unverfügbares und nie an sich vollständig Wahrnehmbares hinein. Dieser Gedanke kann in letzter Konsequenz nur auf der tiefsten intentionalen Schicht vollzogen werden, wo also nichts mehr, was das konkrete Ich ausmacht, in Betracht kommt. Auf dieser tiefsten intentionalen Struktur ist vom Ich das andere Ich notwendig mitgesetzt, „auch wenn alle fremde Leiblichkeit fortfiele und ich zum solus ipse würde.“ 166Damit ist auf der anderen Seite mit größter Deutlichkeit festgestellt, dass das andere Ich nie an sich wahrgenommen wird, sondern immer nur appräsentiert, d. h. durch „Vergegenwärtigung hindurch erfolgende Mitsetzung einer Ichgegenwart, die nicht die meine ist“ 167, aber in meiner tiefen intentionalen Struktur bereits beschlossen liegt.
Indem Husserl die leibnizschen Monaden mit Fenstern versehen hat, hat er sie auf die Welt und insbesondere den Anderen hin geöffnet. Henry tut ähnliches und betrachtet den Punkt, an dem das Ich im Tiefsten auf Gott und damit auch den Nächsten hin offen ist, weil
„das Verhältnis zwischen den transzendentalen Sich [sic!] und dem absoluten Leben die religiöse Verbindung (religio) voraussetzt. Nicht so, als würde jedes von ihnen als Träger dieser Verbindung sein Verhältnis zum anderen erzeugen, sondern … weil es von dieser Verbindung her sein eigenes Sich besitzt sowie damit zugleich die Möglichkeit, sich auf den anderen zu beziehen.“ 168
In der Selbsterscheinung des Absoluten Lebens „in seiner ursprünglichen Ipseität […] entsteht und bildet sich in einer ursprünglich phänomenologischen Möglichkeit jede denkbare Gemeinschaft.“ 169
Aus diesem innersten Punkt heraus manifestiert sich – Henry spricht gar von „zeugen“ 170– das Erscheinen des absoluten Lebens im Erscheinen von Welt. Gerade aus der Selbsterscheinung des absoluten Lebens in jedem einzelnen ergibt sich für ihn eine zwingende soziale Dimension, da „das in jeder Gemeinschaft Gemeinsame das Leben ist“ 171. Damit erhält das Ich , das als in letzter Instanz konstituierendes der Anonymität preisgegeben werden müsste 172, seine Bestimmung im Zusammenspiel mit dem Anderen. Die zwischenmenschliche Beziehung ist deswegen nicht irgendeine Möglichkeit, sondern sie ist konstitutiv für das Ich selbst. Mit anderen Worten: Ohne die Beziehung zum anderen wäre das Ich nicht so, wie es ist, und zwar in ontologischer Hinsicht, nicht nur moralisch oder charakterlich.
Der Ursprung des Ich aus der Extramundanität des Ur-Ich ist auch für den Anderen bedeutsam. Denn aus ihr folgt, dass auch der Andere nicht einfach nur äußerlich vom Ich unterschieden ist, sondern in seinem eigenen Ich -Sein anders ist als das Ich , dabei aber seinerseits eine Sichtweise auf mich hat 173. Beides entspricht einander: Ich begegne einem Anderen und entdecke, dass er in seiner phänomenologisch reduzierten Subjektivität genau so wenig in der Welt vorkommt wie ich und sich genau so sehr an der Welt konstituiert wie ich. Er bleibt deshalb nicht der Andere überhaupt, sondern wird Mensch 174. Am Anderen wird dem Ich die eigene Wirklichkeit vor Augen geführt.
„Haben wir fremde Subjekte hereingenommen in unsere subjektive Umwelt, so haben wir dadurch eo ipso uns hinein genommen in unsere Umwelt.“ 175
So wird in der Hineinnahme des Anderen die Struktur deutlich, die einen Dialog, ein Gespräch miteinander zu tragen vermag.
1.1.1.5Einwände gegen den phänomenologischen Zugang zur Intersubjektivität?
Die Phänomenologie und insbesondere der in ihr sich zeigende intersubjektive Ansatz verlangen danach, den Schritt der Epoché so zu vollziehen, dass die Strukturen des Bewusstseins freigelegt werden und dass nicht mehr inhaltliche Gegenstände den Blick auf diese verstellen. Dafür legen Husserl und auch Henry Zeugnis ab. Nicht alle Denkansätze der jüngsten Zeit gehen den Weg mit, die Epoché bis in diese letzte Konsequenz durchzuführen. Insbesondere im Bereich des Ego scheinen sie entweder nicht die Notwendigkeit zu sehen oder aber nicht den Schritt zu wagen, den Leib und die Psyche radikal auszuklammern. In der Tat ist dies ein operativer Schritt im Denken, der nicht nur außergewöhnliche Herausforderungen an ein theoretisches Abstraktionsvermögen stellt, sondern sich als gegenläufig erweist zu den Erkenntnissen und Postulaten moderner Psychologie, die das Ich in seiner physio-psychischen Verfasstheit mitnichten einzuklammern gestatten, sondern es vielmehr immer mehr in den Vordergrund rücken.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.