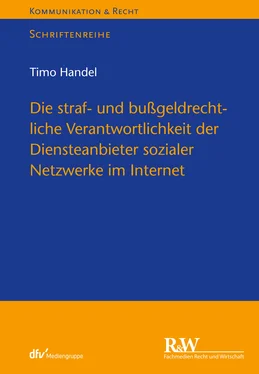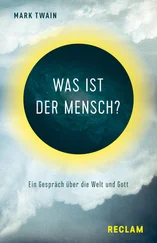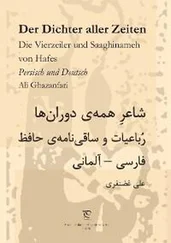Beispielhaft wird regelmäßig der Fall genannt, dass ein US-Amerikaner einen anderen US-Amerikaner in englischer Sprache, in einem englischsprachigen Forum, das auf einem Server in den USA gehostet bzw. gespeichert wird, beleidigt.245 Sofern diese Beleidigung von einem Internetnutzer im Inland zufällig abgerufen bzw. wahrgenommen wird, ist § 185 StGB erfüllt und ein Beleidigungserfolg im Inland gegeben.246 Das deutsche Strafrecht wäre anwendbar.
Dies erscheint jedoch wegen der Zufälligkeit des Erfolgseintritts im Inland und des daher grundsätzlich fehlenden Inlandsbezugs als unbillig. Würde bereits der zufällige Erfolgseintritt im Inland zur Anwendung deutschen Strafrechts genügen, würde dies übertragen auf andere Jurisdiktionen dazu führen, dass sich Diensteanbieter und Nutzer ggf. hunderten Rechtsordnungen gegenüber verantworten müssten und diese selbst dann zu beachten wären, wenn die Diensteanbieter und Nutzer ihre Geschäftstätigkeit und Handlungen überhaupt nicht auf sie ausrichten, was schlicht unzumutbar wäre;247 schlimmer noch: Sie wären selbst dann strafrechtlich verantwortlich, wenn die Handlung in ihrem Heimatland, von welchem aus sie gehandelt haben, straffrei ist.248 Zudem müssten die deutschen Staatsanwaltschaften wegen des Legalitätsprinzips des § 152 Abs. 2 StPO bei jeder über das Internet verbreiteten und in Deutschland strafbaren Information zunächst einmal Ermittlungen aufnehmen.249
Die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts ist deshalb – nach überzeugender Auffassung – auch bei Vorliegen eines zum Tatbestand gehörenden Erfolgs im Inland von einem zusätzlichen und besonderen Inlandsbezug der Tat abhängig zu machen.250 Denn gerade grenzüberschreitende Internetsachverhalte bedürfen im Hinblick auf das Völkerrecht eines sinnvollen und legitimierenden Anknüpfungspunkts zum Inland, um die Anwendung des nationalen Rechts zu rechtfertigen.251 Der bloße Umstand, dass bei Internetsachverhalten ein weltweiter Abruf der nach deutschem Recht rechtswidrigen Information möglich ist und damit auch Nutzer in Deutschland diese abrufen und wahrnehmen können, begründet für sich genommen keinen sinnvollen und legitimierenden Anknüpfungspunkt.252
Zur Begründung eines besonderen Inlandsbezugs, der über den bloßen Erfolgseintritt im Inland hinausgehen muss und damit die Anwendung deutschen Strafrechts rechtfertigt, werden mit einem objektiven (siehe aa.) und einem subjektiven (siehe bb.) Ansatz sowie einem Rückgriff auf § 7 StGB (siehe cc.) im Wesentlichen drei Begründungsansätze vertreten. Zudem stellt sich die Frage, ob die Anwendung des deutschen Strafrechts durch Art. 296 EGStGB ausgeschlossen sein könnte (siehe dd.).
aa. Der objektive Ansatz eines besonderen Inlandsbezugs
Zum Teil findet sich die Auffassung, dass die Tat einen objektiven besonderen Bezug zu Deutschland haben muss.253 Dieser soll dann zu bejahen sein, wenn strafbare Informationen „in deutscher Sprache erscheinen, wenn sie sich speziell auf deutsche Sachverhalte oder Personen beziehen oder wenn aus sonstigen Gründen ein besonderer, für andere Länder nicht vorliegender Anknüpfungspunkt an Deutschland gegeben ist“.254
bb. Der subjektive Ansatz eines besonderen Inlandsbezugs
Demgegenüber ist es nach dem subjektiven Ansatz erforderlich, dass der Täter gerade „über das Internet in Deutschland wirken will“ und diesbezüglich ein „finales Interesse“ hat.255
cc. Rückgriff auf § 7 StGB zur Begründung eines besonderen Inlandsbezugs
Eine weitere Auffassung will den besonderen Inlandsbezug unter Rückgriff auf § 7 StGB begründen. Danach ist es erforderlich, dass „sich die Tat gegen einen Deutschen richtet (arg. e § 7 Abs. 1 StGB), der Täter zur Zeit der Tat Deutscher war bzw. es nach der Tat geworden ist (arg. e § 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB) oder der Täter zur Zeit der Tat Ausländer war, im Inland betroffen und nicht ausgeliefert wird (arg. e. § 7 Abs. 2 Nr. 2 StGB)“.256
dd. Nichtanwendbarkeit deutschen Strafrechts analog Art. 296 EGStGB?
Zudem stellt sich die Frage, ob Art. 296 EGStGB zu einer Beschränkung der Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts führen könnte, da dieser jedenfalls für § 86 Abs. 1 StGB in Bezug auf Zeitungen und Zeitschriften eine Einschränkung vorsieht. Danach ist § 86 Abs. 1 StGB nicht anzuwenden auf Zeitungen und Zeitschriften, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des EGStGB, also im Ausland, in ständiger, regelmäßiger Folge erscheinen und dort allgemein und öffentlich vertrieben werden.
Zweck der Regelung war der Zeitungsaustausch zwischen der früheren DDR und der BRD.257 Mag im Hinblick auf die Verbreitung noch eine analoge Anwendung der Voraussetzungen des allgemeinen und öffentlichen Vertriebs in Betracht kommen, gilt das nicht für eine Übertragung auf andere Straftatbestände. Denn der Vertrieb einer Schrift erfolgt allgemein, wenn „sie einem individuell nicht bestimmbaren Personenkreis zugänglich [ge]macht“ wird, und ist öffentlich, wenn „der Verkauf ‚in der Öffentlichkeit‘ geschieht“, also „im Straßenhandel, in Kiosken oder in öffentlich zugänglichen Buchhandlungen“.258 Die so hergestellte Öffentlichkeit kann durchaus noch als mit einer über das Internet hergestellten Öffentlichkeit vergleichbar betrachtet werden. Eine analoge Anwendung kann sich jedoch wenn überhaupt nur auf die Zeitungen und Zeitschriften und damit einen Ausschluss des § 86 Abs. 1 StGB für den Online-Bereich beziehen. Durch den alleinigen und ausdrücklichen Verweis auf § 86 Abs. 1 StGB macht der Gesetzgeber deutlich, dass Schriften unter den Voraussetzungen des Art. 296 EGStGB allein in Bezug auf diesen Straftatbestand privilegiert sein sollen, während andere strafbare Inhalte weiterhin vom deutschen Strafrecht erfasst werden sollen.259 Die Regelung ist als Ausnahmevorschrift eng auszulegen, weshalb eine analoge Erweiterung auf andere Straftatbestände ausscheidet.
Eine analoge Anwendung des Art. 296 EGStGB zur Begrenzung der Anwendbarkeit deutschen Strafrechts bei Internetsachverhalten und insbesondere der Verbreitung von Inhalten über soziale Netzwerke ist damit grundsätzlich abzulehnen.
ee. Hier vertretene Auffassung
Überzeugend ist allein der subjektive Ansatz zur Begründung eines besonderen Inlandsbezugs, sodass der Täter eine Wirkung seiner Tat im Inland wollen muss.260
Ein Rückgriff auf § 7 StGB ist abzulehnen, da der nötige Inlandsbezug damit zu eng würde. Denn über § 7 StGB würden grundsätzlich nur „deutsche Staatsbürger geschützt oder als Täter bestraft“.261
Zwar wird dem subjektiven Ansatz teilweise entgegengehalten, dass die Rechtsanwendungsvorschrift des § 9 StGB nicht zum gesetzlichen Tatbestand gehört und daher nicht vom Vorsatz umfasst sein muss.262 Jedoch wird dabei verkannt, dass § 9 Abs. 1 Var. 4 StGB für den Fall des Versuchs gerade auf die Vorstellung des Täters von dem Ort des Erfolgseintritts abstellt und damit für die Anwendung deutschen Strafrechts die subjektive Zielrichtung des Täters berücksichtigt.263 Insoweit kann auch nicht der Einwand überzeugen, dass es „eines umfangreichen Prozesses“ bedürfe, „um festzustellen, ob der Täter Auswirkungen auf das deutsche Staatsgebiet beabsichtigt hatte“, was im Widerspruch zur Einordnung der fehlenden Anwendbarkeit deutschen Strafrechts als Prozesshindernis stehe.264 Sofern der subjektive Ansatz damit abgelehnt wird, dass dieser die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts „zur Disposition des Einzelnen“ stellt,265 ist dem ebenfalls entgegenzuhalten, dass für den Versuch gerade auf die subjektiven Vorstellungen des Handelnden abgestellt wird. Aber auch sonst kommt es für eine Strafbarkeit wegen des nach § 15 StGB grundsätzlich erforderlichen Vorsatzes regelmäßig auf die Vorstellungen des Täters und Teilnehmers an.
Читать дальше