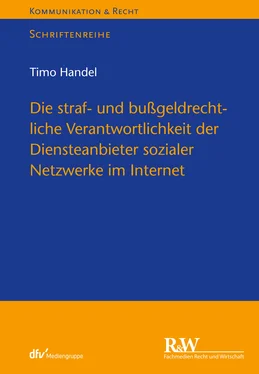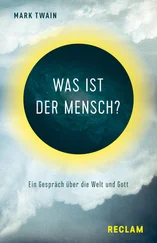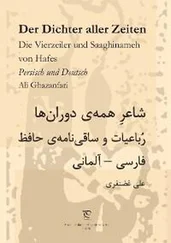b. Das Sitzland von Videosharingplattform-Anbietern
Ausdifferenzierte Sonderregelungen zur Bestimmung des Sitzlandes sehen die Absätze 4 bis 7 des § 2a TMG, die Art. 28a Abs. 2 bis 4 AVMD-RL in deutsches Recht umsetzen, für Videosharingplattform-Anbieter vor.288 Entsprechende Regelungen in Bezug auf das NetzDG sollen mit § 3d Abs. 2 und 3 NetzDG-E geschaffen werden.289
Ist ein Videosharingplattform-Anbieter – nach den gerade dargestellten Voraussetzungen des § 2a Abs. 1 TMG (siehe oben a.) – nicht im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats niedergelassen, so gilt derjenige Mitgliedstaat als Sitzland, in dessen Hoheitsgebiet ein Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen des Videosharingplattform-Anbieters (§ 2a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 TMG) oder ein anderes Unternehmen einer Gruppe, von welcher der Videosharingplattform-Anbieter ein Teil ist (§ 2a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 TMG), niedergelassen ist.
Sofern mehrere der vorgenannten Unternehmen in Bezug auf den Videosharingplattform-Anbieter existieren und in verschiedenen Mitgliedstaaten niedergelassen sind, bestimmt § 2a Abs. 5 TMG eine Rangfolge der Unternehmen zur Bestimmung des Orts der Niederlassung des Diensteanbieters. Dieser bestimmt sich primär nach dem Ort der Niederlassung des Mutterunternehmens (§ 2a Abs. 5 Nr. 1 TMG). Ein Mutterunternehmen i.S.d. Regelung ist ein Unternehmen, das ein oder mehrere Tochterunternehmen kontrolliert (§ 2 Satz 1 Nr. 17 TMG). Die Kontrolle kann unmittelbar und mittelbar erfolgen, wie die Legaldefinition des Tochterunternehmens in § 2 Satz 1 Nr. 18 TMG verdeutlicht.
Ist das Mutterunternehmen nicht in einem Mitgliedstaat niedergelassen, ist auf den Mitgliedstaat abzustellen, in dem das Tochterunternehmen niedergelassen ist (§ 2a Abs. 5 Nr. 2 TMG). Tochterunternehmen ist ein Unternehmen, das unmittelbar oder mittelbar von einem Mutterunternehmen kontrolliert wird (§ 2 Satz 1 Nr. 18 TMG). Wenn es mehrere solche Tochterunternehmen gibt und jedes dieser Tochterunternehmen in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist, gilt der Videosharingplattform-Anbieter in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem eines der Tochterunternehmen zuerst seine Tätigkeit aufgenommen hat, sofern eine dauerhafte und tatsächliche Verbindung mit der Wirtschaft dieses Mitgliedstaats besteht (§ 2a Abs. 6 TMG).
Nicht geregelt ist der Fall, dass in verschiedenen Mitgliedstaaten jeweils ein Tochterunternehmen niedergelassen ist, in einem anderen Mitgliedstaat jedoch mehrere Tochterunternehmen, z.B. zwei oder drei, niedergelassen sind. In diesem Fall bestimmt sich die Niederlassung des Videosharingplattform-Anbieters aber ebenso nach § 2a Abs. 6 TMG, sodass er in einem Mitgliedstaat als niedergelassen gelten kann, in dem er weniger Tochterunternehmen unterhält als in einem anderen Mitgliedstaat.
Gibt es kein Tochterunternehmen oder sind diese allein in Drittstaaten niedergelassen, gilt der Videosharingplattform-Anbieter als in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem das oder die anderen Unternehmen der Gruppe niedergelassen ist oder sind (§ 2a Abs. 5 Nr. 3 TMG). Eine Gruppe ist die Gesamtheit von Mutterunternehmen, allen seinen Tochterunternehmen und allen anderen mit dem Mutterunternehmen und seinen Tochterunternehmen wirtschaftlich und rechtlich verbundenen Unternehmen (§ 2 Satz 1 Nr. 19 TMG).
Sofern es mehrere Unternehmen gibt, die Teil der Gruppe sind und von denen jedes in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist, so gilt der Videosharingplattform-Anbieter als in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem eines dieser Unternehmen zuerst seine Tätigkeit aufgenommen hat, sofern eine dauerhafte und tatsächliche Verbindung mit der Wirtschaft dieses Mitgliedstaats besteht (§ 2a Abs. 7 TMG). Auch in Bezug auf die Unternehmen einer Gruppe ist der Fall nicht ausdrücklich geregelt, dass in einem Mitgliedstaat mehrere solche Unternehmen niedergelassen sind, während in anderen Mitgliedstaaten jeweils nur ein Gruppenunternehmen seine Niederlassung hat. Aber auch insoweit ist davon auszugehen, dass sich die Bestimmung der Niederlassung nach den Vorgaben des § 2a Abs. 7 TMG richtet.
3. Telemedien, die in Deutschland angeboten oder verbreitet werden
Erforderlich ist nach § 3 Abs. 2 TMG zudem, dass die Telemedien in Deutschland angeboten und verbreitet werden. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn sie sich an Nutzer im Inland richten, also zur Nutzung in Deutschland bestimmt sind.
Dieses Anbieten oder Verbreiten muss innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie 2000/31/EG und der Richtlinie 2010/13/EU stattfinden. Es muss sich also um Dienste handeln, die dem Anwendungsbereich der ECRL und AVMDRL unterfallen.
4. Geschäftsmäßige Telemedien
In Bezug auf das Herkunftslandprinzip gilt es aber zu beachten, dass von diesem nur solche Telemedien, also auch soziale Netzwerke,290 erfasst sind, die von dem Diensteanbieter geschäftsmäßig angeboten oder verbreitet werden. Der Begriff der Geschäftsmäßigkeit ist dabei nicht deckungsgleich mit dem Begriff der Gewinnerzielungsabsicht, sondern geht in seiner Reichweite über diesen hinaus. Geschäftsmäßig ist jedes Telemedium, das mit oder ohne Absicht der Gewinnerzielung nachhaltig erbracht oder angeboten wird.291 Im Ergebnis fallen damit allein solche Telemedien aus dem Anwendungsbereich des Herkunftslandprinzips heraus, die „private Gelegenheitsdienste“ darstellen.292
Ein soziales Netzwerk, das als „privater Gelegenheitsdienst“ erbracht wird, ist kaum denkbar. Insbesondere die großen sozialen Netzwerke, auf die das Netz-DG Anwendung findet, sind geschäftsmäßig erbrachte Telemedien. Dies gilt schon deshalb, da die Anwendung des NetzDG verlangt, dass das soziale Netzwerk mit Gewinnerzielungsabsicht erbracht wird (§ 1 Abs. 1 Satz 1 NetzDG).
5. Einschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs
Eine Einschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs liegt mit dem Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht jedenfalls immer dann vor, wenn das Verhalten des Diensteanbieters anders als in Deutschland im Herkunftsland nicht straf- bzw. bußgeldbewehrt ist.293
Eine extensive Auslegung will eine Einschränkung bereits dann annehmen, wenn deutsches Strafrecht oder Ordnungswidrigkeitenrecht auch nur eingreift und zwar selbst dann, wenn das Verhalten im Niederlassungsstaat ebenfalls strafbar bzw. bußgeldbewehrt ist.294
Demgegenüber verneint eine weitere Ansicht eine Einschränkung, wenn das deutsche Strafrecht bzw. Ordnungswidrigkeitenrecht in seinen Rechtsfolgen milder ist als das Recht des Niederlassungsstaats.295
Nach überzeugender Auffassung ist aber eine Einschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs bereits dann zu verneinen, wenn das Verhalten des Diensteanbieters im Herkunftsland straf- bzw. bußgeldbewehrt ist.296 Denn in diesem Fall ist das Verhalten des Diensteanbieters im Herkunftsland unzulässig. Sofern es nun in Deutschland ebenfalls bei Strafe oder Geldbuße unzulässig ist, besteht der gleiche Zustand wie im Herkunftsland. Ob der Straf- bzw. Bußgeldrahmen über denjenigen des Herkunftslands hinausgeht, ist dabei irrelevant. Denn durch die in ihrer Quantität abweichende Rechtsfolge wird das Verhalten nicht „unzulässiger“. Die Straf- bzw. Bußgeldhöhe hat gerade keinen Einfluss auf die generelle Unzulässigkeit des Verhaltens und der damit für den Diensteanbieter einhergehenden Einschränkung. Ist das Verhalten des Diensteanbieters bereits im Herkunftsland unzulässig, kann eine in Deutschland ebenfalls gegebene Unzulässigkeit des Verhaltens schon denklogisch nicht zu einer Einschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs führen.297
Wollte man diesem Ergebnis die Gefahr einer Doppelbestrafung des Diensteanbieters entgegenhalten, ist eine solche wegen Art. 54ff. SDÜ und insbesondere Art. 6 EUV i.V.m. Art. 50 GRCh weitgehend ausgeschlossen.298 Zusätzlich sind in diesem Zusammenhang § 51 Abs. 3 StGB und § 153c StPO zu beachten. Hingegen findet Art. 103 Abs. 3 GG keine Anwendung, da dieser nur einer „mehrmalige[n] Verurteilung [...] durch deutsche Gerichte“ entgegensteht.299
Читать дальше