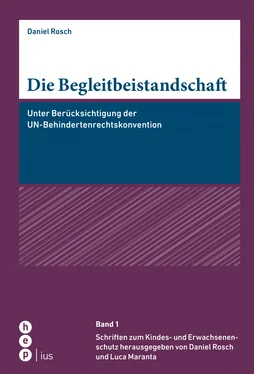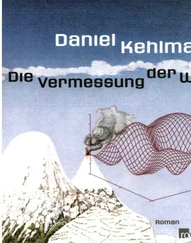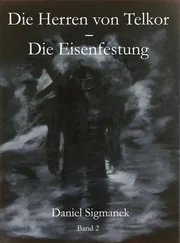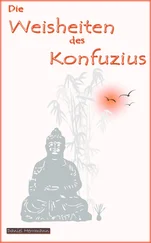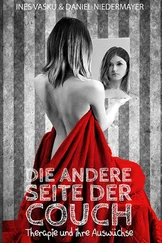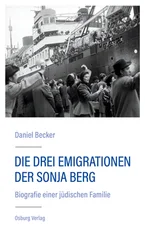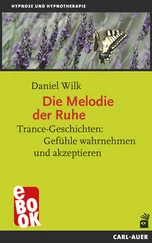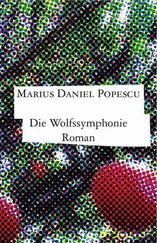7.1Schweigepflicht (Art. 413 Abs. 2 ZGB)
7.2Reaktive Informationsweitergabe
7.3Aktive Informationsbeschaffung bzw. -weitergabe
7.3.1Informationsbeschaffung bei der Übernahme des Amtes (Art. 405 Abs. 1 ZGB)
7.3.1.1Informationsbeschaffung und Begleitbeistandschaft
7.3.1.2Vergleichbarkeit mit Art. 308 Abs. 1 ZGB?
7.3.1.3Schlussfolgerungen
7.3.2Die Orientierungspflicht über die Beistandschaft (Art. 413 Abs. 3 ZGB) und die Durchbrechung der Schweigepflicht (Art. 413 Abs. 2 ZGB)
8.Die Berichterstattungspflicht (Art. 411 ZGB)
9.Mitwirkungspflichten bei zustimmungsbedürftigen Geschäften
10.Pflichten im Zusammenhang mit der Vermögenssorge
11.Die Vertretung ausserhalb der behördlichen Massnahme bzw. der Begleitbeistandschaft
11.1Möglichkeiten der privatautonomen Vertretung
11.2Eignung der Instrumente neben einer (Begleit-)Beistandschaft
11.3Art. 416 Abs. 3 ZGB als Grenze
11.4Folgen in Bezug auf die Verantwortlichkeit
11.5Folgen in Bezug auf die Aufsicht, Berichterstattung und Entschädigung
11.6Weitere methodische Aspekte
11.7Schlussfolgerungen
12.Kombinationsmöglichkeiten mit anderen behördlichen Instrumenten des Erwachsenenschutzes
12.1Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Beistandschaftsarten (Art. 397 ZGB)
12.1.1Verhältnis zur Vertretungsbeistandschaft (Art. 394 f. ZGB)
12.1.2Verhältnis zur Mitwirkungsbeistandschaft (Art. 396 ZGB)
12.1.3Verhältnis zur umfassenden Beistandschaft (Art. 398 ZGB)
12.1.4Folge der Kombinationsmöglichkeiten: Häufigere Mehrfachbeistandschaften?
12.2Kombination mit Öffnen der Post und Betreten der Wohnung (Art. 391 Abs. 3 ZGB)
12.3Kombination mit Art. 392 ZGB
12.4Kombination mit anderen Instrumenten des Erwachsenenschutzes
V.Die «Beschwerde» nach Art. 419 ZGB und die Beendigung der Massnahme
1.Die «Beschwerde» nach Art. 419 ZGB
1.1Legitimation
1.2Anfechtungsgegenstand und -frist
1.3Anwendbares Verfahrensrecht und Kognition
1.4Exkurs: Verfahrensrechte zwischen Schutzinteressen, Drittinteressen und verfassungsmässigen Ansprüchen
1.5Bedeutung für die Begleitbeistandschaft
2.Die Beendigung der Massnahme
2.1Die Beendigung und deren Voraussetzungen
2.1.1Die Beendigung ex lege und auf Antrag hin
2.1.2Bedeutung für die Begleitbeistandschaft
2.2Folgen der Beendigung
TEIL 3 HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE BEGLEITBEISTANDSCHAFT DURCH DIE UN-BEHINDERTENRECHTSKONVENTION
I.Grundlagen
1.Einleitung
2.Zwecksetzung und Entstehungsgeschichte
3.Überblick über die Bestimmungen der UN-Behindertenrechtskonvention
II.Ausgewählte für die Begleitbeistandschaft relevante Aspekte
1.Behindertenbegriff und Erwachsenenschutz
2.Schwächezustände gemäss Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB und Behindertenrechtskonvention
3.Die Art und Weise der Unterstützung aus Sicht der Behindertenrechtskonvention im Vergleich zum Behindertengleichstellungsgesetz
4.Die Unterstützung im Sinne von Art. 12 BRK im Besonderen und Erwachsenenschutz
4.1Ausgangslage
4.2Legal capacity und Rechts- und Handlungsfähigkeit gemäss schweizerischem Privatrecht
4.3Geeignete Massnahmen nach Art. 12 Abs. 3 und 4 BRK
4.4Vertretung als Unterstützung?
4.4.1Ausgangslage
4.4.2Selbstbestimmung und Vertretung im Erwachsenenschutz
4.4.2.1Behördliche Ebene
a)Massschneiderung, Subsidiarität und Verhältnismässigkeit als Garanten der Selbstbestimmung
b)Qualifizierte Beweislast für behördliche Massnahmen
c)Präzise und wissenschaftsbasierte Abklärungen
d)Selbstbestimmung durch Beistandschaften und durch das Verfahren
e)Verbesserungsmöglichkeiten
4.4.2.2Mandatsführungsebene
a)Der behördliche Auftrag als Verpflichtung zur Selbstbestimmung
b)Autonome Handlungsspielräume zur Selbstbestimmung
c)Dualistisches System zwischen Rechtsmacht und selbstbestimmteren Rechtshandlungen
d)Die fremdbestimmte Selbstbestimmung des Beistandes
e)Staatlich eingesetzter Beistand als Schranke der Selbstbestimmung?
f)Verbesserungspotenzial
4.4.3Schlussfolgerungen
4.5Schlussfolgerungen für die Begleitbeistandschaft
III.Ansätze zur Förderung der Autonomie im Entscheidungsprozess bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen und an der Grenze der Urteilsunfähigkeit
1.Förderung der Autonomie bei Urteilsfähigen mit kognitiven Einschränkungen
2.Supported Decision Making gemäss der Behindertenrechtskonvention
2.1Subsitute Decision Making
2.2Supported Decision Making
2.3Das Spektrum von Subsitute zu Supported Decision Making
3.Ansätze und Konzepte zur Förderung des Supported Decision Making
3.1Mehrfachbeistandschaft
3.1.1Beschreibung
3.1.2Beurteilung für die Begleitbeistandschaft
3.2Rechtliche bzw. persönliche Assistenz
3.2.1Beschreibung
3.2.2Beurteilung für die Begleitbeistandschaft
3.3Shared Decision Making
3.3.1Beschreibung
3.3.2Beurteilung für die Begleitbeistandschaft
3.4Clearing Plus
3.4.1Beschreibung
3.4.2Beurteilung für die Begleitbeistandschaft
3.5Supported Network/Trusted-Person-Ansatz
3.5.1Beschreibung
3.5.2Beurteilung für die Begleitbeistandschaft
3.6Aufsuchende Vertrauensperson
3.6.1Beschreibung
3.6.2Beurteilung für die Begleitbeistandschaft
3.7Familienrat-Ansatz/Circle-Network
3.7.1Beschreibung
3.7.2Beurteilung für die Begleitbeistandschaft
3.8Peer-Group-Ansatz
3.8.1Beschreibung
3.8.2Beurteilung für die Begleitbeistandschaft
3.9Choose-Get-Keep-Leave
3.9.1Beschreibung
3.9.2Beurteilung für die Begleitbeistandschaft
4.Einordnung der diversen Konzepte und Ansätze
5.Ausdehnung auf Menschen an der Grenze zur Urteilsunfähigkeit?
5.1Grenzen von Supported Decision Making und Begleitbeistandschaften
5.2Kommunikationsverhalten als Mitursache für Urteils(un)fähigkeit
Читать дальше