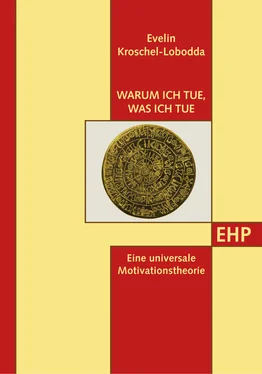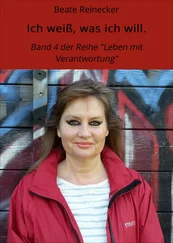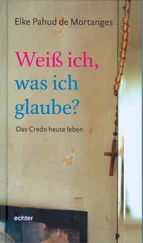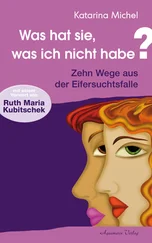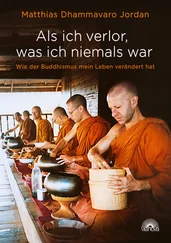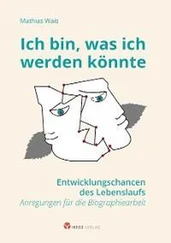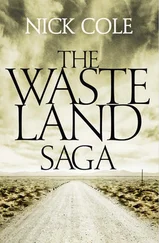Die Vertreter der kognitivistischen Theoriesind der Meinung, dass es nicht die Ereignisse sind, auf welche die Menschen mit Gefühlen reagieren, sondern ihre Vorstellungen über diese Ereignisse. Sie interessieren sich vor allem für die Denkvorgänge und haben herausgefunden, dass wir bewusst oder unbewusst ständig an alles, was wir wahrnehmen, ein Bewertungsraster anlegen und unsere Emotionen dann durch diese Bewertungen ausgelöst werden. So lässt z. B. eine Mischung der Bewertungen unerfreulich + unvorhergesehen + fremdverursacht ein Gefühl des Zorns entstehen.
Ganz sicher ist es so, dass wir dieses unaufhörliche Bewertungsraster in unseren Denkprozessen haben – allein es greift zu kurz, die Gefühle nur auf diese Bewertungen zurückzuführen. Die kognitivistische Theorie betrachtet einen den Empfindungen und Gefühlen nachgelagerten Denkprozess, aus dem dann weitere Emotionen resultieren. Der Neurowissenschaftler Joseph Ledoux drückt das so aus: »Die Bewertungstheorien haben sich mehr mit Anlässen als mit Ursachen befasst.« 2 So bemängelt z. B. auch Antonio Damasio, 3 einer der führenden Emotionsforscher, dass sich die Kognitionswissenschaft weder mit der Homöostasefunktion noch mit der organismischen Funktion der Emotionen beschäftige. Für ihn gehört die Emotion untrennbar zur Logik des Überlebens.
Die kulturrelativistische Theorievertritt die Ansicht, dass es keine angeborenen universalen Gefühle gibt, sondern dass Gefühle Teile einer Kultur seien, die in der Kindheit und Jugend sozialisiert, d. h. gelernt werden, und dass es dementsprechend in unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Epochen auch unterschiedliche Gefühle gibt. So zogen die Verfechter der kulturrelativistischen Position beispielsweise die Beobachtung der kanadischen Anthropologin Jean Briggs, dass die Angehörigen des Volks der Inuit niemals in Zorn gerieten, als Beweis dafür heran, dass Zorn keine universale menschliche Emotion sei. Tatsache ist jedoch, dass Briggs (sie lebte in den Sechziger-Jahren längere Zeit bei den Inuit in den West-Northern-Territories) zwar beobachten konnte, dass bei den Inuit Zorn niemals gezeigt oder ausagiert wurde, dass dies aber nur darauf zurückzuführen war, dass er in höchstem Maße kontrolliert wurde. »Die Kontrolle der Emotionen genießt bei den Eskimos hohe Wertschätzung, und wenn sie unter den beschwerlichsten Umständen ihren Gleichmut bewahren, gilt das als wichtigstes Zeichen von Reife, von einer Erwachsenen-Haltung.« 4 Die Inuit bewerten zorniges Verhalten als »nutaraqpaluktuq«, das bedeutet ungefähr kindisches Benehmen. Diese Zuschreibung zeigt, dass die Inuit den Zorn also durchaus bei ihren Kindern beobachten, sonst könnten sie ihn nicht als kindisch bewerten, die Erziehung aber dann stark dahingehend wirkt, dass das Erleben und der Ausdruck von Zorn strikt unterdrückt wird. In einer so unwirtlichen Gegend (bis in die Fünfziger-Jahre hatten Hungersnöte die Eskimostämme dezimiert) ist eine uneingeschränkte Solidarität innerhalb der Gruppe die Voraussetzung zum Überleben. Der Zorn mit all seinen Risiken – wie Spaltung der Gruppe oder Ächtung von Einzelnen – wurde als zu gefährlich betrachtet, um toleriert zu werden.
Die langjährige Vormachtstellung der kulturrelativistischen Theorie ist inzwischen durch viele Forschungen der letzten Jahrzehnte massiv in Frage gestellt worden. Wie das Beispiel der Inuit zeigt, liegen die kulturellen Unterschiede nicht darin, dass die Menschen in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Gefühle hätten, sondern dass in verschiedenen Kulturen die Emotionen je nach ihren gesellschaftlichen Bedürfnissen unterschiedlich bewertet und dementsprechend ihre Wahrnehmung und ihr Ausdruck unterschiedlich sozialisiert werden. So ist z. B. das Gefühl des Ekels universal – wovor sich Menschen in unterschiedlichen Kulturen und Epochen ekeln, ist jedoch sozialisiert. Genauso ist auch das Gefühl der Angst universal – wovor sich Menschen ängstigen ist jedoch kulturell und zeitgeistig unterschiedlich.
In der evolutions-psychologischen Theoriewird der Standpunkt vertreten, dass wir Emotionen verspüren, weil sie unserem Überleben dienen. Die Vertreter dieser Position sind überzeugt, dass Emotionen sich im Laufe der menschlichen Entwicklungsgeschichte durch viele Selektionen herausgebildet haben und zu unserem genetischen Erbe gehören. Darwin hielt sechs Emotionen für universal: Freude, Überraschung, Traurigkeit, Angst, Ekel und Zorn. Dafür spricht, dass sich emotionale Reaktionen wie Erschrecken (als eine Form von Überraschung), Freude, Angst, Ekel und Zorn beim Menschen schon im frühesten Säuglingsalter zeigen – eine Tatsache, die der Theorie, dass Gefühle nur aus Denkprozessen entstehen, entgegensteht.
Ein berühmter Neurowissenschaftler auf dem Gebiet der Emotionsforschung ist Joseph Ledoux. Auch er hält die Emotionen für Funktionen des Organismus, die dem Überleben dienen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass wir eine neue Herangehensweise an das emotionale Gehirn brauchen, weil die Theorie vom limbischen System im Gehirn als Sitz der Emotionen überholt sei, da kaum etwas für die Existenz dieses Systems oder für seine Beteiligung an der Emotion spreche: »Die Theorie des limbischen Systems war eine Theorie der Lokalisation. Sie wollte uns verraten, wo die Emotion im Gehirn angesiedelt ist. Doch McLean und spätere glühende Verfechter des limbischen Systems konnten uns nicht verlässlich sagen, welche Teile des Gehirns denn nun tatsächlich zum limbischen System gehören. […] Aus heutiger Sicht bestand sein Fehler wohl darin, das ganze emotionale Gehirn und seine Evolutionsgeschichte in ein einziges System zu packen. […] Die Emotionen sind sehr wohl Funktionen, die dem Überleben dienen. Da die einzelnen Emotionen aber an unterschiedlichen überlebenswichtigen Funktionen beteiligt sind, kann es sehr wohl sein, dass sie jeweils andere Hirnsysteme in Anspruch nehmen, die sich aus unterschiedlichen Gründen entwickelt haben. Es könnte dementsprechend nicht bloß ein emotionales System im Gehirn geben, sondern etliche.« 5
Neben den philosophischen, anthropologischen, neurobiologischen und psychologischen Wissenschaften haben sich auch die Soziologen mit Emotionen beschäftigt. Der soziologische Blick auf Emotionen ist vor allem geprägt von Fragestellungen im Zusammenhang mit der Gesellschaft, z. B. wie Emotionen sozial geprägt werden und welche Wirkungen sie zeitigen. Die Beschäftigung der Soziologie mit den Emotionen ist noch nicht sehr alt, weil angeblich die Väter der Soziologie die Emotionen als soziologisch ungeeignete Untersuchungsgegenstände ablehnten. Wie Flam 6 ausführt, entstand eine ausgesprochene Soziologie der Emotionen erst etwa Mitte der 1970er-Jahre in den USA mit Untersuchungen von Funktion und Einfluss von Emotionen in ausgewählten eichen wie z. B. im Umgang mit Geld, in der Politik oder am Arbeitsplatz. Inzwischen wird der Erforschung des Zusammenhangs von sozialen Strukturen und Emotionen viel Aufmerksamkeit gewidmet.
Die Entdeckung der Spiegelneurone des italienischen Hirnforscherteams um Giacomo Rizzolatti 7 hat nun die Emotionsforschung auf fundamentale Weise bereichert. Die Spiegelneuronen bieten nicht nur die biologische Erklärung für Phänomene wie Mitgefühl und Mitleid, sondern auch dafür, wie es möglich ist, von Gefühlen – und damit Bedürfnissen und Motiven – anderer infiziert zu werden. Die Wissenschaftler der Universität von Parma fanden Nervenzellen, in denen sich spiegelt, was andere tun und welche Gefühle sie zum Ausdruck bringen – und nannten diese Nervenzellen ›Spiegelneurone‹. Das bedeutet, dass dann, wenn wir eine Handlung beobachten, unsere Spiegelneurone genauso funken, wie sie es im Falle der eigenen Handlung tun, und wenn wir bei jemandem starke Gefühle wahrnehmen, dann funken unsere Spiegelneurone genauso, wie wenn wir selbst diese Gefühle hätten. Diese Spiegelneurone sind zuständig für Empathie und Mitleid, für unsere Einfühlungsfähigkeit; so sind sie z. B. auch dafür verantwortlich, wenn wir bei traurigen Filmen weinen oder uns bei gruseligen Psychoschockern fürchten (sofern wir uns nicht ständig bewusst machen, dass wir nur Zuschauer eines Kunstprodukts sind). Sie sind auch für das Phänomen verantwortlich, das in der Massenpsychologie schon lange als Resonanzphänomen bezeichnet wird. 8 Das heißt, dass Gefühle einer Menschenmenge auf bisher Unbeteiligte ›überspringen‹ und dadurch bei diesen die gleichen Gefühle entstehen. Das gilt jedoch nicht nur für die Massenpsychologie, sondern für jede zwischenmenschliche Beziehung. 9 Jeder von uns kennt das Phänomen, dass sich unser Gefühlszustand durch den Gemütszustand eines Gesprächspartners stark verändern kann, dass man sich von Gefühlen anstecken bzw. ›ergreifen‹ lässt. Der Hirnforscher Christian Keysers drückt das so aus: »Unser Gehirn ist bei weitem nicht so privat, wie wir dachten. Es erlebt die Zustände anderer Menschen mit.« 10
Читать дальше