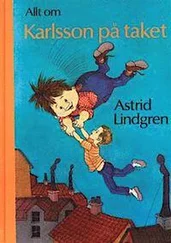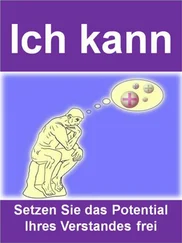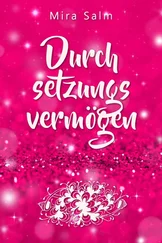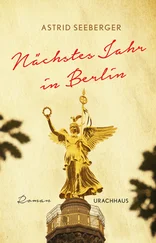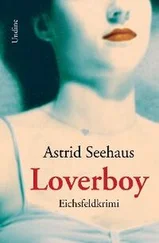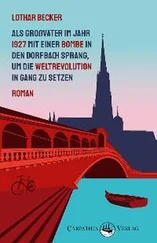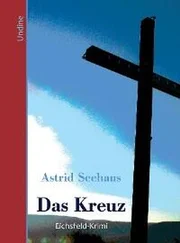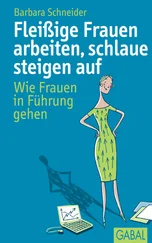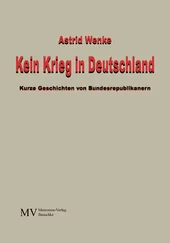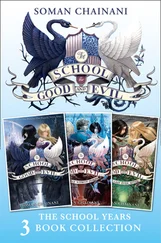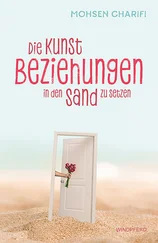• withitness Allgegenwärtigkeit, mit der Klasse sein
• overlapping Überlappen
• momentum Reibungslosigkeit und Schwung
• smoothness Geschmeidigkeit
• group focus Wahrung eines Gruppenfokus und Gruppenmobilisierung
• managing transition Übergangs-Management
• avoid mock participation Vermeiden vorgetäuschter Teilnahme
Diese Techniken entspringen Beobachtungen aus einem lehrerzentrierten Unterricht, sind aber, wie die weitere Forschung zeigt, ebenfalls für den schülerzentrierten Unterricht von hoher Bedeutung. «Der Besitz von Fertigkeiten zur Führung einer Gruppe erlaubt es dem Lehrer, seine Lehrziele zu erreichen – mangelnde Führungskunst schafft Barrieren.» [4]
Techniken der Klassenführung bei Evertson
Seit den 1990er-Jahren definiert eine Gruppe um Carolyn M. Evertson, Professorin für pädagogische Psychologie in den USA, handlungsorientierte Dimensionen für einen störungsarmen Unterricht. [5]Diese Liste der Techniken der Klassenführung nach Evertson wurde 2017 letztmals ergänzt. Entscheidend für den Ansatz ist, dass die Lehrkräfte sich auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler konzentrieren und dieses steuern. Auch wenn hier ursprünglich vom Unterricht in Grundschulen ausgegangen wurde, sind die Dimensionen für alle Stufen bedeutsam, die Techniken überall anwendbar. [6]Im Mittelpunkt steht die zwischen Lehrenden und Lernenden geteilte Verantwortung. Der schülerzentrierte Unterricht erfolgt nach demokratischen Prinzipien. Die Lehrkraft sorgt für gute Bedingungen und moderiert den Lernprozess. Dafür braucht es eine vorausschauende Planung. Evertsons Dimensionen guten Unterrichts bieten hierfür wichtige Anhaltspunkte. Sie liefern viele konkrete Handlungsideen, Techniken und Aspekte, die für die eigene Klassenführung anregend und förderlich sind. [7]
| TECHNIK DER KLASSENFÜHRUNG |
RELEVANTE ASPEKTE |
| Den Klassenraum und das Material vorbereiten |
–Vier bzw. fünf Schlüssel für eine gute Raumanordnung–Vorschläge für das Lernarrangement im Klassenzimmer |
| Regeln und Verfahrensweisen im Klassenzimmer aufstellen |
–Klassenregeln ausarbeiten–Verfahrensweisen in der Klasse ausarbeiten |
| Verfahrensweisen für die Steuerung der Schülerarbeitsphasen |
–Klare Kommunikation der Arbeitsaufträge und Arbeitsvorgaben–Überwachen/Monitoring des Arbeitsfortschritts und der Erledigung von Arbeitsaufträgen–Rückmeldung/Feedback an Schülerinnen und Schüler |
| Einen gelungenen Start bereiten |
–Ein positives Klassenklima schaffen–Regeln und Verfahrensweisen unterrichten (mit dem Untertitel «Autorität der Lehrkraft»)–Planungen für einen guten Beginn (die ersten Schultage, typische Aktivitäten, Kommunikation mit Eltern und Vormund usw.) |
| Unterricht planen und durchführen |
–Planung des Unterrichtsangebots–Kounins Ideen/Begriffe für die Unterrichtsführung in der Großgruppe–Häufige Probleme bei der Unterrichtsdurchführung–Übergänge–Klarheit |
| Führen von kooperativen Lerngruppen |
–Strategien und Routinen für kooperatives Lernen entwickeln–Schülerarbeitsphasen und -verhalten überwachen–Gruppeninterventionen–Fertigkeiten für effektive Gruppenarbeit–Kooperatives Lernen einführen |
| Angemessenes Schülerverhalten aufrechterhalten |
–Überwachen/Monitoring von Schülerverhalten–Konsequenz–Umgang mit unangemessenem Verhalten–Schaffung eines positiven Klimas durch Anreize und Belohnungen–Vorsicht im Umgang mit Belohnungen |
| Kommunikationsfähigkeiten für das Unterrichten |
–Konstruktive Bestimmtheit–Empathisches Reagieren–Problemlösendes Agieren–Mit Eltern sprechen |
| Mit Verhaltensproblemen umgehen |
–Kategorisierung von problematischem Verhalten–Ziele für den Umgang mit Verhaltensproblemen–Strategien für den Umgang mit Verhaltensproblemen–Spezifische Probleme (Mobbing, Tuscheln, chronische Arbeitsverweigerung, Schlägereien, Machtkämpfe)–Erinnerung zum Schluss: positiv denken und handeln |
| Mit besonderen Gruppen umgehen |
–Leistung einschätzen/diagnostizieren–Sondergruppen festlegen–Strategien für individuelle Unterschiede–Arbeiten mit Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen (Lernschwäche/Lernbehinderung, Verhaltensauffälligkeiten, emotionale Probleme, Autismus-Spektrum-Störung usw.)–Unterricht mit lernschwächeren Schülerinnen und Schülern–Unterricht mit lernstarken Schülerinnen und Schülern |
| Unterstützende und gesunde Beziehungen im Klassenzimmer aufbauen [8] |
–Was sind Beziehungen?–Selbstmanagement als Aspekt des Beziehungsaufbaus–Bedeutung von Grenzsetzungen in Beziehungen–Strategien zum Aufbau von Beziehungen–Lehrer-Schüler-Beziehungen in städtischen Umgebungen |
Merkmale guten Unterrichts
Classroom management ist spätestens seit Ende der 1990er-Jahre auch im deutschsprachigen Raum ein zentrales Thema. Es entstanden zahlreiche Konzepte von Klassenführung und Unterrichtsqualität. Eines, das bis heute große Aufmerksamkeit erfährt, ist jenes des deutschen Pädagogikprofessors Hilbert Meyer. Er definierte die im Folgenden gelisteten zehn Merkmale guten Unterrichts. [9]Dabei nennt er die Klassenführung nicht explizit als Merkmal, einige Merkmale lassen sich jedoch der Klassenführung zuordnen:
•klare Strukturierung des Lehr-Lern-Prozesses,
•intensive Nutzung der Lernzeit,
•Stimmigkeit der Ziel-, Inhalts und Methodenentscheidungen,
•Methodenvielfalt,
•intelligentes Üben,
•individuelles Fördern,
•lernförderliches Unterrichtsklima,
•sinnstiftende Unterrichtsgespräche,
•regelmäßige Nutzung von Schüler-Feedback,
•klare Leistungserwartungen und -kontrollen.
Andreas Helmke, Erziehungswissenschaftler und Professor für pädagogische Psychologie, nahm die Klassenführung als eigenen Qualitätsbereich in seine Liste der Merkmale guter Unterrichtsqualität auf: [10]
•Klassenführung,
•Klarheit und Strukturiertheit,
•Konsolidierung und Sicherung,
•Aktivierung,
•Motivierung,
•lernförderliches Klima,
•Schülerorientierung,
•Kompetenzorientierung,
•Umgang mit Heterogenität,
•Angebotsvariation.
Was guter Unterricht überhaupt ist, leitet Helmke aus seinem Angebots-Nutzungs-Modell ab (siehe hierund Abbildung 2). Die Fragestellungen, die zum guten Unterricht führen, lauten: «Gut wofür? Gut für wen? Gut gemessen an welchen Startbedingungen? Gut aus wessen Perspektive? Gut für wann?» [11]
Ebenfalls in Deutschland und zeitgleich mit Helmke beschäftigten sich die Psychologen Hans-Peter Nolting und Gert Lohmann [12]mit einem Teilbereich der Klassenführung, der Unterrichtsstörung. Tatsächlich erleben Lehrkräfte diesen Aspekt ja als sehr bestimmend in ihrem täglichen Unterrichtshandeln.
Bei Nolting ist das präventive Lehrerhandeln zentral für eine vorbeugende Konfliktlösung; er empfiehlt verschiedene präventive Strategien während des Unterrichts, nämlich:
•Prävention durch Regeln und Organisation,
•Prävention durch breite Aktivierung,
•Prävention durch Unterrichtsfluss,
•Prävention durch Präsenz- und Stoppsignale.
Treten Konflikte auf, so kann die Lehrkraft lehrerzentriert handeln, dabei möglichst sparsam (knapp und schnörkellos) reagieren und so schnell wie möglich zum Unterricht zurückkehren. Eine klare Rahmensetzung und ein Anreizsystem statt Strafen sind für Nolting Gelingensfaktoren präventiv wirksamer Klassenführung. Bei wiederkehrenden Konflikten sollte die Lehrkraft die Schüleraktionen verstehen lernen, bevor sie lehrerzentriert oder kooperativ handelt. Um kooperative Lösungen zu erreichen, schlägt Nolting eine kooperative Gesprächsführung vor (z. B. nach Thomas Gordon oder Alexander Redlich und Wilfried Schley).
Читать дальше