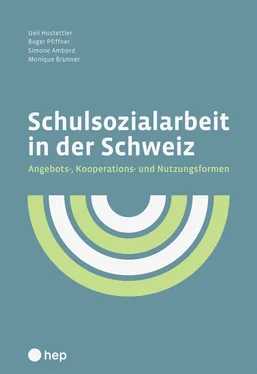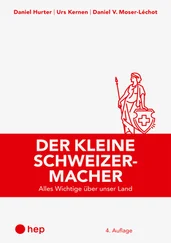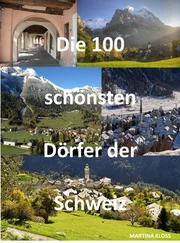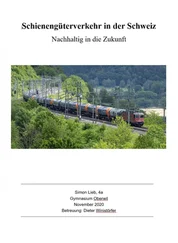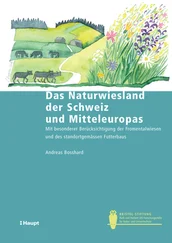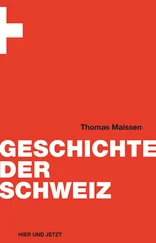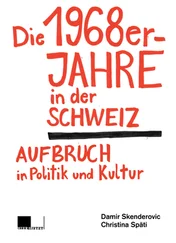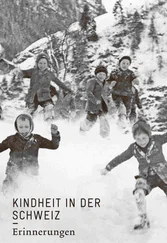2 Entwicklung der Schulsozialarbeit und Angebotsformen
Die Schulsozialarbeit wurde an Schweizer Schulen seit den 1960er-Jahren eingeführt (Brunner, Ambord, 2018). Das nun folgende Kapitel dokumentiert auf der Basis der Erkenntnisse unserer Studie und weiterer Quellen die Entstehung und Verbreitung der Schulsozialarbeit mit Fokus auf der deutschsprachigen Schweiz. Weiter geht es um Fragen der Ausgestaltung verschiedener Angebotsformen. Nach einer Einführung werden diese Themen der Reihe nach bearbeitet. Das Kapitel schliesst mit einem Zusammenzug der wesentlichen Befunde.
2.1 Einführung ins Thema
2.1.1 Inhaltlicher Fokus des Kapitels und Fragestellungen
Die Schulsozialarbeit hat sich als neues Handlungsfeld der Sozialen Arbeit im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt und nach zunächst vereinzelten frühen Angeboten in der Westschweiz in den 1960er-Jahren seit Ende der 1970er-Jahre in der Deutschschweiz erst langsam, aber nachhaltig verbreitet (Baier, 2008; Vögeli-Mantovani, Grossenbacher, 2005). Unsere Zahlen zeigen, dass in den deutschsprachigen Kantonen derzeit über tausend Schulsozialarbeitende in der Primarstufe und Sekundarstufe I tätig sind (siehe Tabelle 2). An der Schnittstelle zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Schule unterstützen sie Kinder und Jugendliche bei einer für sie befriedigenden Lebensbewältigung (AvenirSocial, Schulsozialarbeitsverband [SSAV], o.J.). Die Angebote der Schulsozialarbeit fokussieren auf das Wohl der Kinder und Jugendlichen, richten sich aber auch an Schulleitungen, Lehrpersonen, Eltern und weitere Personen aus dem sozialen Umfeld der Schülerinnen und Schüler.
Durch die föderalistischen Strukturen und die hohe Autonomie der Gemeinden haben sich konzeptionell und strukturell sehr unterschiedliche Organisationsmodelle der Schulsozialarbeit herausgebildet. Sie unterscheiden sich beispielsweise in Bezug auf die personelle Ausstattung, die räumlichen Bedingungen in den Schulen oder auch hinsichtlich der Kooperationsstrukturen und Trägerorganisationen. Obwohl diese Aspekte einen entscheidenden Einfluss auf die Leistungen der Schulsozialarbeit haben, ist bisher nur wenig über die allgemeinen Rahmenbedingungen in der deutschsprachigen Schweiz bekannt. Dies hängt damit zusammen, dass die bisherige Forschungstätigkeit zur Organisation der Schulsozialarbeit geprägt ist von schul- oder projektbezogenen, teilweise regionalen Implementations- und Evaluationsstudien, deren Ergebnisse sich nicht ohne Weiteres für die ganze Deutschschweiz verallgemeinern lassen. Zwar gibt es mittlerweile erste kantonale Bestandsaufnahmen (Drilling et al., 2006; Fabian, 2012; Neuenschwander et al., 2007; Pfiffner et al., 2013), aber auf nationaler Ebene liegt unseres Wissens nur eine einzige Untersuchung vor (Gschwind, 2014).
Vor diesem Hintergrund beschreibt dieses Kapitel die Entwicklung und Organisation der Schulsozialarbeit in der deutschsprachigen Schweiz. Zuerst wird auf Basis bestehender Literatur zur Schulsozialarbeit die Entwicklung der Schulsozialarbeit seit den 1960er-Jahren nachgezeichnet. Anschliessend vergleichen wir unsere eigenen Daten zu den Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit mit den in der Fachliteratur und von den Fachorganisationen empfohlenen Richtlinien zu den Rahmenbedingungen und untersuchen, wieweit diese heute in der Praxis der Schulsozialarbeit umgesetzt sind. Dabei stehen die folgenden drei Fragestellungen im Mittelpunkt:
Wann und wie hat sich die Schulsozialarbeit entwickelt?
Wie ist die Schulsozialarbeit heute organisiert?
Welche Leistungen bietet die Schulsozialarbeit an?
Ziel der Analyse ist eine Bestandsaufnahme zur Verbreitung, Organisation und den Tätigkeitsbereichen der Schulsozialarbeit in der Deutschschweiz. Damit wird der aktuelle Zustand der Schulsozialarbeit dokumentiert und eine empirisch abgestützte Grundlage zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit bereitgestellt.
2.1.2 Historische Entwicklung der Schulsozialarbeit in der Schweiz
Die Entstehungsgeschichte der Schulsozialarbeit in der Schweiz wurde in den letzten Jahren in verschiedenen Publikationen ausführlich dargestellt (Baier, 2008; Baier, Heeg, 2011; Drilling, 2009; Gschwind, 2014). Diese Arbeiten zeigen, dass die Entwicklung und Ausbreitung der Schulsozialarbeit in hohem Masse durch das föderalistische System der Schweiz sowie durch sprachregionale und regionale Unterschiede geprägt ist (Baier, 2008; Gschwind, 2014), also landesweit keinesfalls einheitlich verlief. In der französischsprachigen Schweiz entwickelten sich bereits in den 1960er-Jahren verschiedene Modelle der Kooperation zwischen Schule und Sozialer Arbeit mit unterschiedlichen Bezeichnungen, wie beispielsweise «conseillers sociaux», «éducateurs sociaux», «médiateurs scolaires» oder «travailleurs sociaux scolaires». Entsprechend den vielfältigen Bezeichnungen unterscheiden sich die Angebote auch hinsichtlich ihrer sozialpädagogischen, sozialarbeiterischen und animatorischen Mandate (Aarburg, Kottelat, 2018). Gemäss Aarburg und Kottelat (2018) befindet sich die Schulsozialarbeit in der Westschweiz heute noch in einer Pionierphase, die zwar viel Entwicklung zulässt, der es jedoch an institutioneller Sicherheit und gemeinsamen Orientierungspunkten fehlt. Auch der Organisationsgrad der Schulsozialarbeitenden ist in der französischsprachigen Schweiz relativ tief.
Im Vergleich zur Westschweiz begann die Schulsozialarbeit in der Deutschschweiz mit etwa zehn Jahren Verzögerung und vorerst nur mit vereinzelten Projekten, die in den 1970er- und 1980er-Jahren initiiert wurden (Neuenschwander et al., 2007; Vögeli-Mantovani, Grossenbacher, 2005). Der Zeitraum von Beginn bis Ende der 1990er-Jahre wird von Baier (2011a) als Pionierphase der Schulsozialarbeit bezeichnet. In dieser Phase wurde an wenigen Standorten Schulsozialarbeit mit viel Engagement und Eigenverantwortung der Fachpersonen vor Ort aufgebaut. Diese Angebote hatten oft Modellcharakter und beeinflussten die spätere Entwicklung. An die Pionierphase schliesst seit Ende der 1990er-Jahre laut Baier die Ausbauphase an, die sich durch eine schnelle Verbreitung der Schulsozialarbeit im städtischen Raum auszeichnet. In den grösseren Städten wie Bern, Zürich, Basel, St. Gallen, Luzern und Zug wurden die meisten Projekte der Schulsozialarbeit gestartet, die sich anschliessend zuerst auf die Agglomeration ausweitete und später auch in ländlichen Gebieten eingeführt wurde. Um 2005 setzt dann die Professionalisierungs- und Profilierungsphase der Schulsozialarbeit in der Deutschschweiz ein, die, parallel zum inzwischen auf tieferem Niveau weiterlaufenden Ausbau, bis heute andauert. Sie zeichnet sich durch eine zunehmende Vernetzung der Praxis und durch fachliche Konkretisierung des Profils aus, die durch die Praxis und Wissenschaft gefördert wird (Baier, 2011a).
Mit der Schulsozialarbeit hat sich in den vergangenen Jahren ein neues Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt. Es ist aktuell wohl das am stärksten expandierende Praxisfeld der Sozialen Arbeit. Es ist heute unbestritten, dass ein hoher Bedarf an Schulsozialarbeit besteht; wo sie eingeführt wurde, ist sie kaum mehr wegzudenken. In mehreren Regionen sind deshalb Bestrebungen im Gange, die Schulsozialarbeit flächendeckend in allen Gemeinden einzuführen, Stellen für kantonale Beauftragte einzurichten und bestehende Angebote weiterzuentwickeln (Gschwind, 2014). Die Gründe für die Einführung und Ausdehnung der Schulsozialarbeit sind aber regional sehr unterschiedlich. Sie reichen von der Prävention und Bearbeitung von psychosozialen Problemlagen der Schülerinnen und Schüler oder der Behebung von Störungen im Schulalltag über die Entlastung der Schule und Lehrpersonen bis hin zur Schulentwicklung (Ziegele, 2014).
2.1.3 Organisation der Schulsozialarbeit in der Deutschschweiz
Читать дальше