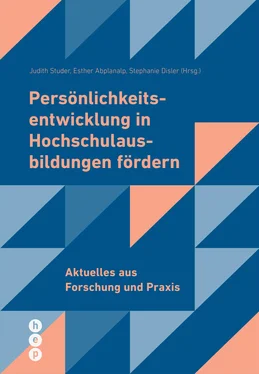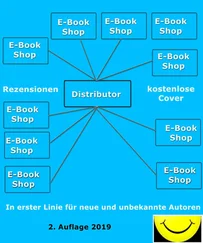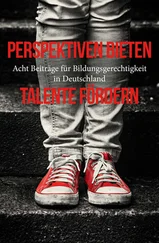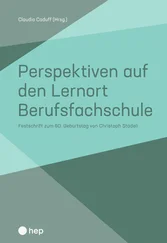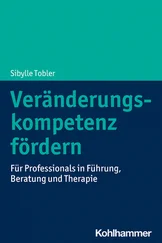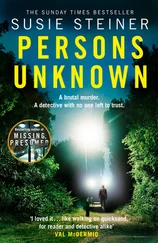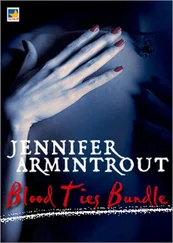Heute, in modernen Kontexten des Denkens, erscheinen dieses antike Verständnis von Wissenschaft und Philosophie und insbesondere die dazugehörige Weltsicht und Wahrheitsauffassung eher als etwas Fremdes – die Grundidee hingegen, dass Menschen ihre Persönlichkeit zielgerichtet zu verändern, zu bilden und zu entwickeln haben, um gut zu leben, hat ihre Faszination bis heute nicht verloren. Bedeutende Strömungen der modernen Philosophie können als Versuch interpretiert werden, das antike Verständnis von Persönlichkeitsbildung als Arbeit am eigenen Selbst in moderne Kontexte des Denkens zu transformieren (Kriza, 2018, S. 213–294). Die Allgegenwart von körperlichen und geistigen Übungsbewegungen in unterschiedlichen Kontexten der Gegenwart belegt die heutige Lebendigkeit derartiger Auffassungen (Sloterdijk, 2009; Kriza, 2018, S. 128–150). Zu diesen Kontexten gehört nicht zuletzt auch der Bildungsbereich.
Die zeitgenössische Philosophiedidaktik kann als Anknüpfung an das antike Philosophieverständnis aus dem Blickwinkel des modernen Menschenbildes interpretiert werden. Der Mensch in der Moderne, begriffen als freies und autonomes Individuum, sieht sich vor die Herausforderung gestellt, seine Freiheit und moralische Verantwortlichkeit stets erst herausbilden zu müssen. Die Philosophiedidaktik versteht hierbei Philosophie in einem weitgehenden Konsens als eine Schulung des Selberdenkens in der Tradition des antiken und aufklärerischen Denkens, oft in expliziter Anknüpfung an Sokrates und Immanuel Kant (Tiedemann, 2017b, S. 14 f.; Steenblock, 2017a, S. 30–33; Steenblock, 2017b, S. 58–65; Martens, 2017, S. 41–47). So interpretiert Ekkehard Martens Philosophie als eine «elementare Kulturtechnik» und als Mittel, um «das Selbstdenken und somit die Autonomie der Person zu fördern», und bezieht dabei die Philosophie direkt «auf den Zweck der Persönlichkeitsbildung und eine humane Lebensgestaltung» (Martens, 2017, S. 46). Volker Steenblock verortet philosophische Bildung in der Tradition Platons und Wilhelm von Humboldts im allgemeinen «Bemühen um ein selbst verantwortetes und gestaltetes Wissen» als Grundlage eines menschlichen Lebens, das als Projekt bewusster und autonomer Gestaltgebung aufzufassen ist (Steenblock, 2017b, S. 58, 63–65). In dieser die Antike und Neuzeit verbindenden Traditionslinie wird die menschliche Existenz als die Herausbildung einer Persönlichkeit interpretiert, die «sich aus einem letzten, verantworteten Prinzip heraus zu steuern sucht» (a. a. O., S. 58). Bedingung hierfür ist, dass der Mensch über die relevanten Aspekte, Ziele und Konsequenzen des eigenen Lebens und Denkens reflektiert Rechenschaft geben kann. Die Herausbildung dieser Fähigkeit ist seit jeher eine Kernaufgabe der Philosophie und erstreckt sich insbesondere auch auf die gezielte Schulung der «Urteilskraft, verstanden als Fähigkeit zur kritisch rationalen Argumentation sowie sicheren Verwendung von Begriffen und kategorialen Unterscheidungen» (Tiedemann, 2017a, S. 26).
Die aktuelle Philosophiedidaktik hebt in einem weitgehenden Konsens und zu Recht die Orientierungsfunktion der Philosophie hervor und betont deren besondere Relevanz vor dem Hintergrund heutiger Herausforderungen. So erinnert Julian Nida-Rümelin an den Orientierungsbedarf Jugendlicher in einer komplexen sozialen Welt, die durch globale Verflechtungen und durch eine rasant voranschreitende Technik besondere ethische Fragestellungen mit sich bringt (Nida-Rümelin, 2017, S. 19). Auch Markus Tiedemann betont den besonderen Orientierungsbedarf der Moderne und ruft in Erinnerung, dass geschichtlich Philosophie gerade in Zeiten von Orientierungskrisen ihre Blütezeiten erlebt hat (Tiedemann, 2017a, S. 23). Ethische Neuorientierung ist zwar kein Alleinstellungsmerkmal unserer Zeit, stellt aber heute eine besondere Herausforderung dar, weil die gegenwärtige Innovationsgeschwindigkeit der Technik die Handlungsoptionen und den Entscheidungsbedarf des Menschen ins Unüberschaubare ausweitet und dabei die Dringlichkeit mit sich bringt, weitreichende ethische Entscheidungen auf Grundlage eines fraglich gewordenen kulturellen Wertefundamentes zu fällen (a. a. O., S. 23–26). Als Charakteristikum der heutigen Zeit identifiziert Tiedemann zu Recht die Tatsache, dass dringliche praktische Probleme ethische Entscheidungen erfordern, «deren theoretische Grundlage selbst als problematisch gilt» (Tiedemann, 2017c, S. 71). Die heutigen Anforderungen verlangen daher eine «nachdenkliche Werteentwicklung» statt einer «traditionelle[n] Wertevermittlung», und Adressat hierfür ist nicht zuletzt die Philosophie (Tiedemann, 2017a, S. 27). In die gleiche Richtung argumentiert auch Volker Steenblock, der Bildung und insbesondere philosophische Bildung als «Antwortversuch auf gesellschaftliche Transformationen» in einer kulturellen Situation interpretiert, in der «der Einfluss lebensregelnder und sinnstiftender Traditionen zurückgeht» (Steenblock, 2017b, S. 59, 61). All dies verdeutlicht den heutigen Stellenwert von Persönlichkeitsbildung in Bildungsbereich und die besondere Rolle der Philosophie.
Welche Schlussfolgerungen lassen sich für Hochschulen für angewandte Wissenschaften ziehen? Der Ruf nach Persönlichkeitsbildung an Fachhochschulen wurzelt zunächst unmittelbar in der modernen Auffassung des Menschseins: Insofern sich Menschen als freie und selbstbestimmte, vernünftige und moralische Individuen verstehen, stehen sie vor der Herausforderung, sich als solche herauszubilden. Fachhochschulen sind als Bildungsinstitutionen Orte, an denen Studierende sich als Persönlichkeiten herausgestalten. Daher ist auch das Studium an Fachhochschulen nicht nur als eine Vermittlung von Fachkompetenzen, sondern in einem erweiterten Sinne als eine methodische Unterstützung der Persönlichkeitsbildung der Studierenden zu verstehen – gerade auch im Hinblick auf ihre Fähigkeit, reflektierte moralische Positionen einzunehmen. Philosophie ist, seit ihren antiken Ursprüngen bis in die heutige Zeit hinein, im Kern ein Weg, um die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen bewusst und methodisch zu fördern. Daher liegt es nahe, philosophische Bildung auch an Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu verankern – in Einklang mit der Einsicht, dass die gezielte Förderung der Persönlichkeitsentwicklung auch für Fachhochschulen eine Kernaufgabe darstellt.
Konfligiert die Verortung von Philosophie in Hochschulcurricula mit der Notwendigkeit, in kurzer Zeit fundiertes Fachwissen zu vermitteln? Zu einem gewissen Grad mag dies der Fall sein, jedoch ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich gegenwärtig die Prioritäten in einer bemerkenswerten Weise verschieben. Gerade weil moderne Technik sich mit all ihren Facetten in nie dagewesener Geschwindigkeit weiterentwickelt, weil dabei die Innovationsgeschwindigkeit noch zunimmt und weil sich moderne, entwickelte Gesellschaften in umwälzenden Transformationsprozessen befinden, kann selbst eine konsequent praxisorientierte Hochschulausbildung nicht das primäre Ziel haben, Studierende auf die konkreten Aufgaben der Arbeitswelt vorzubereiten. Selbst in Bildungskontexten, die weitestgehend auf Praxisorientierung ausgerichtet sind und unter hohem Zeit- und Kostendruck stehen, kann eine Ausweitung des Bildungsziels in Einklang mit Effizienzüberlegungen stehen oder gar direkt aus solchen abgeleitet werden. Ein interessantes Beispiel ist die Firma Siemens in den USA: Vor die Aufgabe gestellt, für ein neu zu bauendes Gasturbinenwerk in North Carolina 1500 neue Mitarbeiter zu rekrutieren, hatte sich Siemens aufgrund eines Mangels an qualifizierten Bewerbern erfolgreich dafür entschieden, ein eigenes Trainingsprogramm aufzusetzen und zu finanzieren. Modell hierfür war die aus Deutschland bekannte Berufsausbildung bzw. das duale Studium. In diesem Zusammenhang vor die Frage gestellt, was ein vierjähriges praxisorientiertes Hochschulstudium beinhalten sollte, gab die CEO von Siemens USA, Barbara Humpton, folgende Antwort:
Читать дальше