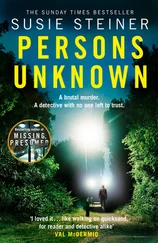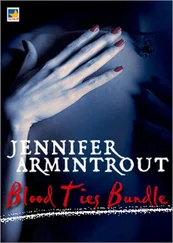Hochschulen für angewandte Wissenschaften «befinden sich aktuell in einem Spannungsfeld zwischen der gesellschaftlichen Verantwortung für die Persönlichkeitsentwicklung der immer jünger werdenden Studierenden und einer anspruchsvollen und tragenden wissenschaftlichen Ausbildung» (Hochschule Coburg, 2015, S. 4). Fachhochschulen wie die Hochschule Coburg definieren eine «ganzheitliche, kulturell und interdisziplinär ausgerichtete Bildung» und die Befähigung zu «gesellschaftlich verantwortlichem Handeln» als Leitbilder und explizit auch als strategische Ziele der Hochschule (Hochschule Coburg, 2015, S. 26, 28). Mit groß angelegten interdisziplinären Projekten wie dem «Coburger Weg»[1] wird nicht zuletzt auch Philosophie zum integralen Bestandteil einer interdisziplinär ausgerichteten, studiengangübergreifenden Lehre, die den Blick der Fachhochschulstudierenden – über den Tellerrand der eigenen Fachlichkeit hinaus – auf wichtige und weitreichende Fragen lenken soll, die sich im persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Leben eines Menschen und nicht zuletzt auch eines jeden Berufsmenschen stellen. Welchen Beitrag leistet Philosophie zur methodischen Förderung der Persönlichkeitsbildung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften?
Begriffe wie «Persönlichkeitsbildung», «Persönlichkeitsentwicklung» und «Persönlichkeitsentfaltung» sind in unterschiedlichsten Praxiskontexten weit verbreitet. Die Begriffsverwendung ist vieldeutig und nicht selten auch floskelhaft, insbesondere wenn die «kritische Reflexion der […] zugrunde liegenden Annahmen, Werte und Menschenbilder» (Rogmann, 2016, S. 142) fehlt. Auch in der Hochschuldidaktik sind diese Begriffe präsent – die vieldeutige Begriffsverwendung geht jedoch nur mit einer spärlichen erziehungswissenschaftlichen Theoriebildung und dazugehörigen empirischen Forschung einher (Budde & Weuster, 2018, S. 5). Trotz der Vielfältigkeit und Vagheit der jeweiligen Definitionen und begrifflichen Verwendungen kreist die Allgegenwart der Forderung nach Persönlichkeitsentwicklung im Kern um die Idee, dass die menschliche Persönlichkeit etwas Gestaltbares und zu Gestaltendes darstellt, dass «Bildung» hierfür eine entscheidende Rolle spielt und dass sich diesbezüglich in der Situation der Moderne und insbesondere in der aktuellen Gegenwart besondere Herausforderungen stellen, die in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kontexten zu bewältigen sind (a. a. O., S. 6 f.).
Verstehbar wird die Idee einer zu bildenden menschlichen Persönlichkeit insbesondere vor dem übergreifenden Hintergrund des modernen Menschenbildes und seiner Ursprünge, die bis in das antike Denken zurückreichen. Dessen Grundpfeiler können im Rahmen dieses Aufsatzes zumindest angedeutet werden: Die antike Auffassung des Menschen als vernunftbegabtes und soziales Lebewesen[2] entfaltet bis in die heutige Zeit ihre bestimmende Wirkung. Die christliche Vorstellung menschlicher Individualität bekam in der Renaissance eine neue Dynamik, löste sich im Verlauf der Neuzeit zunehmend von ihren religiösen Wurzeln ab und radikalisierte sich in der Moderne bis in die Gegenwart hinein (Kriza, 2018, S. 151–213). Zum Kern des modernen Personseins gehören die Idee des freien menschlichen Willens[3] und die Auffassung, dass der Mensch seine Lebensweise frei zu wählen habe[4] – aber zugleich auch die Vorstellung einer Moralität, die in der vernünftigen Autonomie des Menschen ihren Ursprung nimmt.[5] Im modernen Menschenbild verbinden sich freie Selbstbestimmung, moralische Verantwortlichkeit und Rationalität. Der Zusammenhang dieser bestimmenden Facetten kommt in der Vorstellung einer besonderen Würde des Menschen zum Ausdruck. Die abstrakte Idee der Menschenwürde entfaltet ihre Wirkung durch ihre Konkretisierungen, nicht zuletzt in der Ausgestaltung von Menschenrechten (Bielefeldt, 2011, S. 105–144). Die Auffassung des Menschen als freies und selbstbestimmtes, vernünftiges und moralisches Individuum, das sich im Zusammenleben mit anderen Menschen die Gesetze seines Lebens selbst auferlegt und sich in seiner Ganzheit durch eine besondere Würde auszeichnet, konstituiert das moderne Bild des Menschen. An diesem Bild hängen die Idee des Personseins und zugleich auch die Vorstellung, dass die Persönlichkeit des Menschen erst entwickelt, entfaltet bzw. gebildet werden muss.
Das menschliche Leben ist, anders als beim Tier, kein durch Instinkte weitgehend festgelegter Ablauf: Menschen können ihr Leben – sowohl in individueller als auch in gesellschaftlicher Hinsicht – ganz unterschiedlich leben. Und weil sich ihr Leben nicht als ein Automatismus vollzieht, müssen sich Menschen um ihr Leben kümmern: Sie müssen sich aktiv darum bemühen, dass sich ihr Leben zu einem guten Leben entwickelt. Das antike Denken hat hierbei eine bis heute einflussreiche Unterscheidung getroffen: Menschen können entweder ihr Leben einfach laufen lassen, sich nur auf die Befriedigung ihrer unmittelbaren materiellen Bedürfnisse fokussieren, sich den Dynamiken ihres sozialen Umfeldes unreflektiert hingeben – oder aber sie können danach streben, ihr Leben in einer bewussten und reflektierten Weise aktiv zu gestalten und dabei die wertvolleren, höheren Potenziale, die in ihnen als Möglichkeiten angelegt sind, zur Entfaltung kommen zu lassen. Die Interpretation des guten Lebens als ein zielgerichtetes und durch Reflexion begleitetes Streben nach höheren Zielen, nach wertvolleren Weisen des Lebens, nach methodischer Veredelung und Vervollkommnung der Persönlichkeit ist eine Vorstellung, die – trotz aller inhaltlicher Verschiedenheit – die einflussreichen philosophischen und religiösen Strömungen des antiken Denkens mit vielen späteren und gerade auch modernen Auffassungen des guten Lebens verbindet – wenn auch mit entscheidenden Brüchen.[6] Derartige Vorstellungen finden sich bei Platon, Aristoteles, den Stoikern wie auch im Christentum, sie finden sich bei den Denkern der Renaissance und der Aufklärung, sie bilden den Kern des vielzitierten Humboldt’schen Bildungsideals (z. B. Budde & Weuster, 2018, S. 14 f.), und sie befeuern noch das Denken Friedrich Nietzsches, des vermeintlichen Zertrümmerers aller Traditionen (Kriza, 2018, S. 213–220). Hierbei ist es keine Nebensächlichkeit, dass eine kulturell derart wirkungsmächtige Idee – die Auffassung, dass Menschen für ein gutes und glückliches Leben ihre Persönlichkeit aktiv und zielgerichtet bearbeiten und entwickeln müssen – mit Namen und Positionen von Philosophen verknüpft ist. Philosophie stellte in ihren antiken Ursprüngen die zentrale Methode der Persönlichkeitsentwicklung dar, und die dazugehörigen Vorstellungen entfalten bis heute ihren Einfluss. Was bedeutet Philosophie in diesem ursprünglichen Sinn?
In der antiken Vorstellung von Philosophie war der Aspekt der Reflexion direkt mit der Gestaltung des menschlichen Lebens verbunden: Es ging nicht primär um den Entwurf von theoretischen Systemen des Denkens, sondern um die Entwicklung von umfassenden Entwürfen des Lebens. Nach den Werken von Pierre Hadot (1991) und des späten Michel Foucault (2004; 2005, S. 747–776, 902–909) kann annähernd die gesamte antike nachsokratische Philosophie als geistige Übungen verstanden werden, die eine grundlegende Transformation des Lebens zum Ziel hatten (Kriza, 2018, S. 88–101, 114–128; Kriza 2019). Durch die gezielte Herausbildung menschlicher Vernünftigkeit sollte der Blick des Menschen weg vom niederdrückenden Irdischen hin auf etwas Höheres, Göttliches umgelenkt und ausgerichtet werden. Im antiken Streben nach Erkenntnis durch Wissenschaft und Philosophie lag die Bemühung, die eigene Persönlichkeit zu formen: Durch Einblick in die Wahrheit über die Zusammenhänge der Welt und durch Orientierung an der göttlichen kosmischen Ordnung sollte im Menschen eine analoge vernünftige Ordnung zur Entfaltung gebracht werden, um auf diesem Weg ein gutes Leben zu ermöglichen. Die geistigen Übungen der Philosophie hatten, als Arbeit am eigenen Selbst, das Ziel, die Persönlichkeit des Menschen zielgerichtet zu gestalten und zu bilden, um die im Menschen angelegten höheren Möglichkeiten als das wesenhaft Menschliche zur Entfaltung zu bringen.
Читать дальше