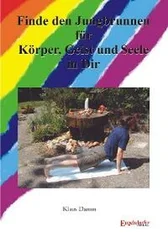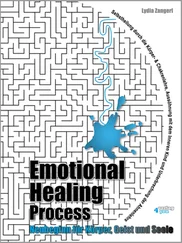Ich falle in meine Erinnerung. Ich falle in meine Weichheit. Wie jung ich war. Voller Zuversicht und Zartheit. Unberührt in eigentümlicher Weise. Die Mutter und ihr Kind. Das Motiv der Madonna mit ihrem Kind. Geschützt und zugleich schützend. Geborgen und zugleich bergend. Es ist ein so langer Weg von mir heute bis zurück, bis hin zu dieser weichen, unberührten Zuversicht. Und doch ist der Weg da. Ist das Früher und das Heute in mir verbunden. Wie dankbar ich bin.
Die Augen der jungen Frau sind eine Spur zu ernst, finde ich. Vielleicht ist das aber auch nur meine Fantasie, weil ich um das Kommende weiß. Wie auch immer. Tief berührt hänge ich das Bild ab und trage es nach Hause. Vorsichtig. Wie wenn ihm nichts geschehen dürfte. Wie wenn die junge Mutter mit ihrem Kind mit behutsamen Händen und mit noch behutsamerem Herzen getragen werden müsste.
Der Abzug löst sich etwas ab von der Sperrholzplatte, auf die mein Vater ihn geleimt hat. Vorsichtig entstaube ich die junge Mutter mit ihrem Kind. Vorsichtig befestige ich den Abzug wieder auf seinem Untergrund. Ich mache das Bild langsam mit meiner jetzigen Wohnung vertraut. Ich lasse beide sich langsam kennenlernen. Ich lasse das Bild einen guten Platz suchen. Das dauert. Im Laufe der letzten Monate hat es schon mehrere Plätze gefunden. Es wandert durch meine Wohnung, bewohnt viele verschiedene Plätze, entfaltet verschiedene Wirkungen in meiner Wohnung – so, wie die Verbindung zu meiner Weichheit durch mich hindurchwandert – bis heute. Ich hätte es früher nicht für möglich gehalten, doch ich entdecke immer wieder aufs Neue und immer wieder staunend, wie empfindlich ich doch bin, wie weich, wie unberührt in gewisser Weise, wie kindlich.
Ich bin meinem Vater dankbar für diese Aufnahme von mir mit meiner ersten Tochter. Ich verstehe bis heute nicht, wie er so ganz dabei hat sein können und zugleich so unsichtbar, so nichtsehend. Wie konnte er nicht sehen, was mit seiner Tochter geschah in den kommenden Jahren? Ich kann ihn nicht mehr fragen. Wäre er noch am Leben, ich glaube nicht, dass er mir antworten könnte. Mein Vater hat auch in den folgenden Jahren einige Fotos von mir gemacht. Es gibt wenige, doch es gibt Aufnahmen aus meiner Prostitutionszeit. Die junge Frau bei Familienfeiern, an Weihnachten bei den Eltern. Wenn mir diese Fotos in die Hände geraten, bin ich jedes Mal aufs Neue erschreckt. Wieso hat das denn keiner gesehen? Es ist doch so offensichtlich! Schau doch bitte mal jemand in die Augen dieser jungen Frau! Tief traurig, tief dunkel, tief verletzt und weit entfernt. Schau doch bitte mal jemand auf die Art, wie sie sich kleidet unter dem Tannenbaum! Als wenn sie durch ihre Kleidung hätte sehen lassen wollen, was sie nicht auszusprechen in der Lage war. Sieht denn da keiner hin? Sind denn hier alle nicht anwesend? Ist denn hier überhaupt noch jemand daheim?
Doch kein Bild hat eine annähernd gleich starke Wirkung auf mich wie die Aufnahme der jungen Mutter, die sich über ihr Kind beugt, es liebevoll hält und anblickt. Sehe ich dieses Bild, dann schaue ich gleichsam auf mich selbst, weich und liebevoll, auf die junge Frau, die junge Mutter, auf ihre Zuversicht und ihr Gottvertrauen, auf die Liebe zu ihrem Kind. Ich bin tief dankbar für diese Liebe, die mich getragen hat, die meine Tochter getragen hat, die alles durchwirkt, die bleibt. Die Liebe, die ist.
Innensicht
Es fängt arglos an
Wie lässt sich rückblickend erklären, was von außen so unverständlich ist? Wie konnte die junge Frau – eine junge Frau wie jede andere, und doch nicht wie jede andere – das tun? Wieso hat sie niemand aufgehalten?
Eine junge Frau ist in einer Bedrängnis. Das ist das Gemeinsame vieler Lebensgeschichten von Frauen, die irgendwann einmal als Prostituierte gearbeitet haben. Die Situation ist meist sowohl emotional als auch finanziell bedrängend. Ohne finanzielle Not kommt äußerst selten eine Frau zur Prostitution. Ohne innere emotionale Not auch nicht. Bei mir kam beides zusammen. Ich hatte kein Geld. Ich fühlte mich emotional abhängig von meinem Mann. Er sagte, wo es langgeht, ohne Rücksicht auf Verluste, auf meine Verluste. Ein Leben ohne ihn konnte ich mir nicht vorstellen, nicht denken, nicht fühlen. Die Gründe für diese Abhängigkeit liegen in meiner Biografie. Das verstand ich erst später. In der damaligen Situation hielt ich diese Abhängigkeit für Liebe. So war für mich die folgerichtige Konsequenz, dass ich alles, was mir irgendwie möglich war, tun wollte, um in dieser Beziehung zu bleiben. Was für mich einen Wert hatte, was Treue zu mir war, war mir nicht nur völlig unwichtig, sondern auch unbekannt. Es galt, die Werte meines Mannes zu beachten. Es galt, in innerer Treue zu ihm zu stehen. Natürlich forderte er das auch ein. Natürlich gefiel es ihm auch, doch diese Einstellung brachte ich auch mit. Die mir heute selbstverständliche Klarheit, sich zuvörderst selbst treu zu sein, die eigenen Werte hochzuachten, die hatte ich damals nicht.
Dazu kam meine Sprachlosigkeit, mein Schweigen. Ich war gewohnt, das, was in mir war, für mich und bei mir zu behalten. Alles Innere, so ich es denn zu erfassen vermochte, machte ich „mit mir alleine aus“. Bei aller inneren Not in meiner Kindheit und als heranwachsendes Mädchen war ich bei allen Entwurzelungen und sexualisierter Gewalt in meiner Einsamkeit und Verwirrung allein geblieben. Es war mir so von Kindheit an vertraut, dass erstens das, was in mir ist, völlig abgetrennt und losgelöst von anderen Menschen ist, zweitens niemand es sieht oder versteht und ich drittens Unverständnis und gar Ablehnung erfahre, wenn ich mein Inneres mitteile. Ich war es gewohnt, eine Fassade zu zeigen. Gewünschtes war mir Befehl. Wie die Außenwelt, die wesentlichen Bezugspersonen, mich haben wollten, so verhielt ich mich. Mich über die Maßen anzustrengen und zu verbiegen, um zu gefallen, um dabeibleiben zu dürfen, um zugehörig zu sein, das war mein Normalzustand.
Überschreiten ihrer eigenen Grenzen
Die junge Frau überschreitet ihre eigenen Grenzen. Es fühlt sich für sie stimmig an, ihrem obersten Ziel verpflichtet: die Beziehung zu ihrem Mann um jeden Preis zu erhalten. Doch sie erkennt ihre Zielsetzung nicht als das, was sie ist: eine hochverstrickte, symbiotische Abhängigkeit. Die junge Frau übersieht, sie „überfühlt“ ihren emotionalen Schmerz, ihre innere Not, ihre innere Ausweglosigkeit. Sie verkauft sich ihr eigenes Verhalten als selbstgewählt, selbstbestimmt. Nach außen antwortet sie auf die Frage, wie sie denn damit leben könne, dass ihr Mann andere Frauen habe, mit denen er Tisch und Bett teile, und wie sie selbst mit diesen Frauen gemeinsam in einem Haus leben könne: „Ganz einfach, ist doch nichts dabei.“ Mit dieser Antwort auf eine Frage, die Verstehen sucht, bewirkt sie eine Vergrößerung des Nichtverstehens. Ihr Verhalten ist unverständlich. Ihre Antwort auch. Eine Antwort, die ihr Verhalten verständlicher machen könnte, müsste lauten: „Ich kann nicht anders. Ich weiß es nicht anders.“ Diese Antwort wäre einer Kapitulation gleichgekommen – davon abgesehen, dass die junge Frau diese Antwort nicht in ihrem Bewusstsein hatte, denn sie war dem bewussten Verstehen entzogen, ins Nichtbewusste verdrängt worden.
Mir wurde mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Bewunderung begegnet. Das gefiel mir. Was mir nicht gefiel, war das, was mein Mann tat, seine anderen Frauen. Es tat mir weh. Ich fühlte mich minderwertig. Ich kam mir als Frau ungenügend vor. Das durfte ich ihm nicht zeigen, denn dann hätte er sich von mir abgewandt. Das durfte ich andere Menschen nicht wissen lassen, denn damit hätte ich meine Abhängigkeit und Ohnmacht eingestanden. Das durfte ich selbst nicht fühlen, denn ich hätte dem Ausmaß meines inneren Ausgeliefertseins nicht standhalten können. So war ich mit meinem Schmerz allein. Meine Angst, Zugehörigkeit und Zuwendung zu verspielen, wenn ich meine Gefühle zeigte oder darüber spräche, war zu groß.
Читать дальше