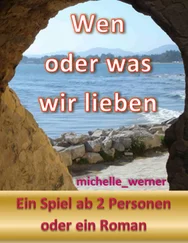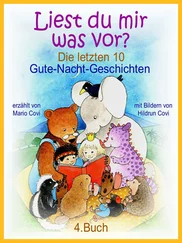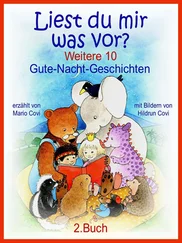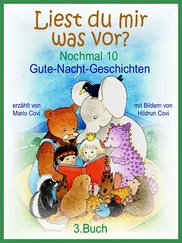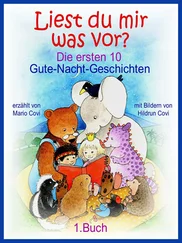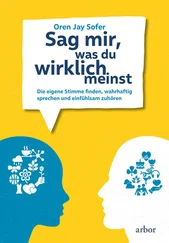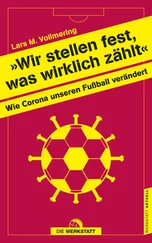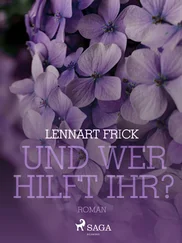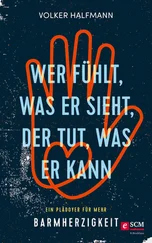In diesem Prozess tragen die Fachpersonen, welche die Jugendlichen im Motivationssemester begleiten, eine große Verantwortung für die Nachhaltigkeit der gefundenen Lösung. Es ist wichtig, in der Zusammenarbeit mit potenziellen Lehrbetrieben auch kritische Punkte anzusprechen und nach Lösungen zu suchen. Dies schafft Vertrauen auf Arbeitgeberseite und ist im Sinne der Nachhaltigkeit zwingend. Im Spannungsfeld zwischen Vermittlungsquote und Nachhaltigkeit ist dies nicht immer einfach. Meine Erfahrungen der letzten Jahre sprechen für eine eher defensive Grundhaltung bei der Wahl des Ausbildungsniveaus.
Drei Jahre in der »Warteschleife« sind eine lange Zeit. Das hat von Jenny außergewöhnlich viel Durchhaltewillen und von ihrem privaten, schulischen und beruflichen Umfeld viel Zuspruch und Motivationsarbeit gefordert. In Bezug auf die Kompensationsfunktion zeigt ihr Fall, dass es ihr gelungen ist, mithilfe der verschiedenen schulischen Angebote im zehnten Schuljahr, im Motivationssemester und in der Vorlehre ihre mathematischen Defizite so weit aufzuarbeiten, dass ihr das erfolgreiche Durchlaufen einer EFZ-Ausbildung möglich wurde. Auch bezüglich ihres Kommunikationsverhaltens gegenüber Erwachsenen hat Jennifer in dieser Zeit durch gezielte Unterstützung große Fortschritte machen können. Biografisch betrachtet, waren diese Jahre für Jennifer sinnvoll.
Wie das Beispiel zeigt, können Berufsintegrations- oder Übergangsmaßnahmen eine Chance sein. Sie liefern einen wichtigen Beitrag zur Begleitung von anforderungsreichen, riskanten Übergangsphasen und tragen zur Chancenoptimierung bei.
Von der Quadratur des Kreises
Berufsvorbereitung im Spannungsfeld unterschiedlicher Förderlogiken
Beatrix Niemeyer und Matthias Rüth
Kaum ein anderes pädagogisches Arbeitsfeld steht in Deutschland derart im Spannungsfeld verschiedener Sozialgesetzbücher wie der Übergang aus der allgemeinbildenden Schule in die berufliche Erstausbildung. Insbesondere bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf treffen unterschiedliche Förderlogiken aufeinander, deren Unterschiede und Widersprüchlichkeiten im beruflichen Integrationsprozess zu erheblichen Reibungsverlusten führen können.
Im Folgenden richten wir den Blick auf die Maßnahmenlandschaft, die in Deutschland seit den 1990er-Jahren gewachsen ist, um vor allem für sogenannte benachteiligte Jugendliche den Weg in den Beruf zu ebnen. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung dieses Übergangssystems, dessen vielfältige Angebote und Aktivitäten auf die Vorbereitung und Qualifizierung für und die Vermittlung in Ausbildung und Erwerb zielen.
Auf der subjektiven Ebene werden diese Entwicklungen im Übergangssystem für die Jugendlichen nicht nur durch unterschiedliche Anforderungen, sondern auch in einer Unübersichtlichkeit der Unterstützungsangebote spürbar. Jugendliche, deren Weg in den Beruf aufgrund bildungsbiografischer, sozialer und/oder gesundheitlicher Schwierigkeiten mehrschrittig verläuft, kommen immer wieder in Situationen, in denen Dinge nicht wie geplant verlaufen. Aufgrund abgebrochener Ausbildungen oder Berufsorientierungsmaßnahmen entstehen für viele Jugendliche Orientierungs- und Entscheidungssituationen, die sie nur in Ausnahmefällen allein bewältigen können. Zusätzlich werden ihnen solche Situationen oftmals als persönliches Versagen ausgelegt, was zu einer nachhaltigen Stigmatisierung führt.
Diese Herausforderungen werden seit einigen Jahren in Deutschland nicht nur thematisiert, sondern auch durch konkrete pädagogische Angebote angegangen.
Bei vielen Ansätzen wurde dabei den kommunalen Gebietskörperschaften die Rolle zugedacht, im Rahmen eines regionalen Übergangsmanagements die notwendigen Abstimmungsprozesse zu moderieren. Inwieweit dieser sehr grundlegende Prozess erfolgreich verläuft, ist noch nicht abschließend zu beurteilen, da erst wenige dieser Modellversuche abgeschlossen und ausgewertet wurden. Allerdings gibt es schon jetzt Hinweise darauf, dass aufgrund der Komplexität und Dynamik des Arbeitsfeldes und seiner politischen und finanziellen Rahmenbedingungen eine Ausrichtung auf monolithische »Ein-für-alle-Mal-Lösungen« nur wenig Erfolg versprechend ist.
Der Begriff der Berufsorientierung wird von uns weit gefasst. Er beinhaltet zum einen den individuellen Prozess der subjektiven Orientierung auf das Erwerbsleben, als Berufsfindungsprozess, der neben anderen Entwicklungsaufgaben als maßgebliches Kriterium für das Gelingen der Statuspassage vom Jugendlichen in das Erwachsenenleben gilt. Zum anderen bezeichnet der Begriff die Vielzahl von Maßnahmen und Aktivitäten, mit denen innerhalb und außerhalb von Schule gezielt das Gelingen dieses Übergangs gesichert werden soll. Die Ausweitung berufsorientierender Angebote und die Entstehung des Übergangssystems sind Indikatoren für die Aspekte eines gesellschaftlichen Wandels, der mit der Subjektivierung von Erwerbsarbeit, veränderten Qualifikationsanforderungen, der Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen und der Globalisierung von Arbeitsmärkten einhergeht. Er stellt alle Akteure, Lehrkräfte, Berufsberater und Berufsberaterinnen, Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe, Jugendliche und Eltern vor Orientierungsprobleme.
Nachfolgend werden wir ausgewählte Aspekte dieser Orientierungsprobleme nachzeichnen und die Dimensionen der Neuorientierung im Spannungsfeld zwischen subjektivem Bewältigungspotenzial und strukturellem Ordnungsbedarf skizzieren. Die beschriebenen Entwicklungen fordern an vielen Stellen eine kritische Betrachtung geradezu heraus. Wir werden diese als Orientierungsbedarf im Übergangssystem thematisieren. Unser Anliegen ist es, einige Leitlinien aufzuzeigen, entlang deren sich solche Orientierungsprozesse vollziehen können. Diese Perspektive ermöglicht es, weitergehende gesellschaftliche Differenzkategorien und Ungleichheitsstrukturen im Einzelnen in den Blick zu nehmen. Die hier notwendigen Auslassungen beziehen sich unter anderem auf Gender-Effekte, Inklusion, Kritik der Erwerbsarbeit und deren Prekarisierung sowie auf soziale Selektionsprozesse des Übergangssystems.
Von der Benachteiligtenförderung zum Übergangssystem
Die ersten Schritte
Die Entstehung des Übergangssystems lässt sich in Deutschland bis ins Jahr 1980 zurückverfolgen. Unter diesem Begriff werden alle Förder- und Qualifizierungsangebote im Anschluss an die allgemeinbildende Schule und im Vorfeld einer Berufsausbildung zusammengefasst. In Reaktion auf die erste große Welle von Jugendarbeitslosigkeit wurde vom damaligen Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft das »Modellprogramm zur Benachteiligtenförderung« eingerichtet, das sich seither in mehreren Zwischenschritten zu einem eigenständigen Bildungssegment weiterentwickelt hat und im Bildungsbericht der Bundesregierung 2006 erstmals als Übergangssystem bezeichnet wurde. Angesichts des offensichtlich nachlassenden Integrationspotenzials des Ausbildungsmarktes wurde damit die besondere Förderung des Übergangs von der Schule in den Beruf für »junge Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen, Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten, schlechten Startchancen nach der Schule, aus Migrantenfamilien oder schwierigem sozialem Lebenskreis ohne Ausbildungs- oder Arbeitsplatz« (BIBB, 2005, S. 2) eingerichtet. Eine gesetzliche Grundlage erhielt das Benachteiligtenförderungsprogramm 1988, indem es in das Arbeitsförderungsgesetz (AFG) aufgenommen wurde. Förderrechtlich zuständig ist für diesen Bereich seither die Bundesagentur für Arbeit. Die Gesamtheit der Maßnahmen der Benachteiligtenförderung war zunächst weniger auf die individuelle Förderung der einzelnen Jugendlichen gerichtet, sondern allgemeiner auf die Abschaffung des seinerzeit neuen Phänomens Ausbildungslosigkeit. Erst zwanzig Jahre später, nachdem vielfältige Angebote der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung innerhalb des Bildungssystems etabliert waren, an berufsbildenden und allgemeinbildenden Schulen und in der kommunalen Jugendberufshilfe, wurde ein systematischer Regelbedarf des Übergangs von der allgemeinbildenden Schule in Ausbildung als Problembereich thematisiert. Die Passung zwischen institutionalisierter Lenkung, betrieblichen Anforderungen und individuellem Bewältigungspotenzial war mit den etablierten Mitteln des Bildungssystems allein offensichtlich nicht mehr herzustellen.
Читать дальше