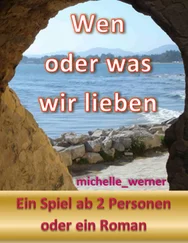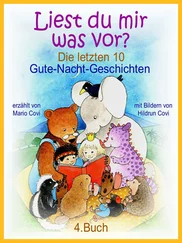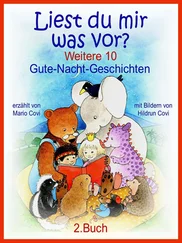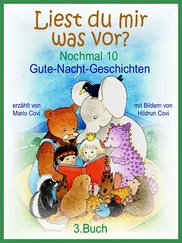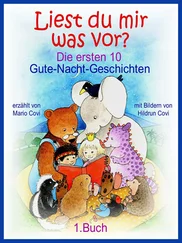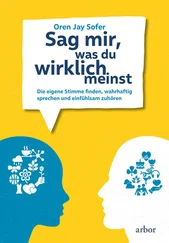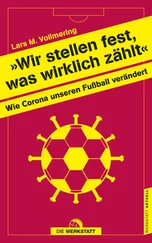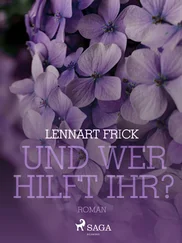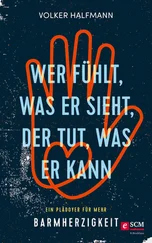Was nun die Wirkung von Brückenangeboten im Sinne eines erfolgreichen Abschlusses einer Sek-II-Ausbildung angeht, so zeigt sich, dass das Durchlaufen eines solchen Angebots im Vergleich zum Direkteinstieg die Chance substanziell vermindert, später noch in eine zertifizierende Sek-II-Ausbildung einzutreten und diese erfolgreich abzuschließen. Im Vergleich zu Direkteinsteigerinnen und -einsteigern mit anfänglich identischen schulischen, familiären und individuellen Voraussetzungen reduziert sich die Chance auf einen Abschluss laut Meyer und Sacchi (i.V.) um 8 bis 17 Prozent. Die Absolventen und Absolventinnen von Brückenangeboten fahren damit zwar immer noch markant besser als die Jugendlichen, die nach Austritt aus der obligatorischen Schule keinerlei Ausbildungslösung haben. Im Vergleich zu dieser Gruppe entfalten Brückenangebote durchaus eine positive Wirkung auf die Abschlusschancen, vermögen aber die negative Wirkung des verpassten Direkteinstiegs nur teilweise wettzumachen.
Kritische Anmerkung
Bei der Beurteilung dieser Ergebnisse aus heutiger Sicht gilt es zu beachten, dass die TREE-Kohorte vor rund zwölf Jahren aus der Schulpflicht entlassen worden ist. Daraus kann die Kritik abgeleitet werden, dass hier historische Prozesse modelliert werden, die heute ganz anders verlaufen. Mit Blick auf eine gewisse Konsolidierung und Professionalisierung der Brückenangebote im vergangenen Jahrzehnt könnte etwa argumentiert werden, dass diese heute eine höhere Akzeptanz bei den abnehmenden Ausbildungsanbietern genießen und deshalb nicht mehr erfolgschancenmindernd wirken. Ein weiterer Einwand betrifft die demografischen Veränderungen an der beobachteten Schnittstelle, die auf eine gewisse Entspannung des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage im Bereich der beruflichen Grundbildung hindeuten. Die weiter oben referierten statistischen Zeitreihen von Bundesamt für Statistik und Lehrstellenbarometer lassen jedoch vermuten, dass sich an der Grundmechanik der beobachteten Allokationsprozesse wenig geändert hat. Empirisch überprüfen lässt sich diese Kritik jedoch erst dann, wenn Längsschnittdaten einer neuen Kohorte zu diesem Übergang vorliegen.
Fazit und Ausblick
Brückenangebote sind bestenfalls die zweitbeste Lösung. Diese Zuspitzung legen die Ergebnisse der Jugendlängsschnittstudie TREE (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) nahe. Diesem provokativen Fazit liegen zwei Beurteilungskriterien zugrunde. Das erste Kriterium fragt nach den Selektionsmechanismen, aufgrund deren Jugendliche nach Erfüllung ihrer Schulpflicht in Brückenangebote rutschen, statt direkt in eine zertifizierende Ausbildung der Sekundarstufe II einzusteigen. Hier zeigen die Analysen der TREE-Daten, dass die Selektion in Brückenangebote nicht in erster Linie aufgrund von individuellen Leistungsdefiziten, Motivations-, Persönlichkeits- oder Orientierungsproblemen erfolgt, sondern vor allem stark beeinflusst wird von Herkunfts- und Strukturmerkmalen wie sozialem Status, Migrationshintergrund oder dem auf Sekundarstufe I besuchten Schultyp (erweiterte Anforderungen vs. Grundansprüche). 14Diese faktischen Selektionsfaktoren stehen in zum Teil krassem Widerspruch zu den bildungspolitisch intendierten bzw. postulierten Funktionen von Brückenangeboten, die vor allem die Behebung individueller Defizite in den Vordergrund rücken.
Eine durchzogene Bilanz weisen die Brückenangebote auch hinsichtlich des zweiten Beurteilungskriteriums auf, des erfolgreichen Abschlusses einer zertifizierenden Ausbildung auf Sekundarstufe II. Hier zeigt sich aufgrund der TREE-Analysen, dass Diskontinuitäten des Ausbildungsverlaufs ein eigenständiger Risikofaktor dafür sind, dass Ausbildungen frühzeitig abgebrochen oder gar nicht angefangen werden. Zu diesen Diskontinuitäten gehören auch die Brückenangebote. Im Vergleich zu den Direkteinstiegen in zertifizierende Sek-II-Ausbildungen wirken diese leicht chancenmindernd, das heißt, das Risiko von Brückenangebotsabsolventinnen und -absolventen, ohne nachobligatorischen Ausbildungsabschluss zu bleiben, ist laut TREE leicht erhöht.
Anders präsentiert sich die Bilanz, wenn man als Vergleichsgruppe nicht die Direkteinsteiger, sondern diejenigen beizieht, die nach Austritt aus der obligatorischen Schule über keinerlei Anschlusslösung verfügen. Im Vergleich zu dieser Gruppe erweist sich das Durchlaufen eines Brückenangebots als signifikanter Schutzfaktor gegen Ausbildungslosigkeit.
Ausblick auf Veränderungen am Übergang in die Berufsbildung
Was hat sich an der kritischen Schnittstelle zwischen Sekundarstufe I und Sekundarstufe II im vergangenen Jahrzehnt verändert?
Durch die Stabilisierung der Lehrstellensituation und die demografische Entspannung hat sich erstens der jahrelange ausgeprägte Nachfrageüberhang im Bereich der beruflichen Grundbildung etwas entschärft.
Mit Blick auf die Jugendlichen mit Migrationshintergrund als ausgeprägte Zielgruppe der Brückenangebote zeichnen sich zweitens Verschiebungen ab, die sich in den kommenden Jahren noch akzentuieren dürften: Zum einen gehen die Anteile der »kritischen« Migrationsgruppen, etwa aus den Balkanländern, der Türkei und Portugal, zurück, die bisher in den Brückenangeboten stark übervertreten waren (vgl. etwa BFS-Publikationsreihe »Schülerinnen, Schüler und Studierende«). Demografisch stark im Vormarsch sind dagegen Jugendliche aus sozioökonomisch gut gestellten Elternhäusern, deren gut gebildete Eltern in den letzten Jahren aus dem EU-Raum eingewandert sind. Diese dürften sich allerdings mehrheitlich eher im Gymnasialbereich bemerkbar machen als im Bereich der Brückenangebote. Insgesamt dürfte sich somit die implizite Funktion der Brückenangebote als Auffangbecken von bildungsfernen Migrantinnen und Migranten eher abschwächen. Es steht demnach zu erwarten, dass in Zukunft eher bildungsferne »Einheimische« und junge Migrantinnen und Migranten aus dem außereuropäischen Raum vermehrt in Brückenangeboten anzutreffen sein werden.
Drittens haben sich die Brückenangebote im vergangenen Jahrzehnt bezüglich Institutionalisierung, funktionaler Differenzierung und Professionalisierung konsolidiert und weiterentwickelt. Davon zeugt auch das vorliegende Buch. Dies kommt zum einen zweifellos den Jugendlichen zugute, die diese Angebote durchlaufen. Zum anderen könnte die institutionelle Festigung auch Anlass und Gelegenheit sein, die Rolle der Brückenangebote innerhalb des Bildungssystems aktiver und gestaltender wahrzunehmen. Mit anderen Worten: Trägerschaften der Brückenangebote handeln mit anderen involvierten Akteuren des Bildungssystems, insbesondere der Sekundarstufe I und der beruflichen Grundbildung, vermehrt aktiv und selbstbewusst die Modalitäten aus, nach denen die erste Schwelle organisiert und gestaltet werden soll.
Verhandlungsgegenstände
Auf der Basis der Ergebnisse des vorliegenden Beitrags drängen sich etwa folgende Punkte als »Verhandlungsgegenstände« auf:
•Die Durchlässigkeit in den Sekundarstufen I und II muss insgesamt größer werden. Die heute ausgeprägte horizontale und vertikale Segmentation und Segregation führt dazu, dass die Übergangsprozesse kleinräumig, unübersichtlich, zum Teil außerordentlich langwierig, sozial hochgradig selektiv und in etlichen Fällen mit dem Risiko behaftet sind, dass Jugendliche letztlich ohne nachobligatorische Ausbildungsabschluss bleiben.
•Die Beurteilungsgerechtigkeit und -qualität schulischer Leistungen muss besser werden. Es geht auf Dauer nicht an, dass Ausbildungsplätze auf Sekundarstufe II aufgrund von schulfremden Instrumenten wie Multicheck usw. und des besuchten Oberstufen-Schultyps vergeben werden. Ein Schritt in die richtige Richtung sind etwa standardisierte Monitoring-Instrumente wie die geplanten HarmoS-Tests 15oder PISA, die längerfristig indirekt einen systematisierenden und harmonisierenden Effekt haben dürften. Aber auch die direkten schulischen Beurteilungsinstrumente bedürfen einer vermehrten Harmonisierung und Standardisierung (z. B. klassen- und schulübergreifende Vergleichsarbeiten). Außerdem sollten die Lehrkräfte noch vermehrt bezüglich Beurteilungsungerechtigkeit aufgrund von Schülermerkmalen wie Geschlecht, sozialer Herkunft oder Migrationsherkunft sensibilisiert werden.
Читать дальше