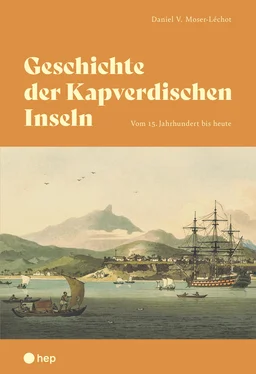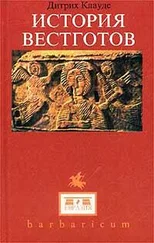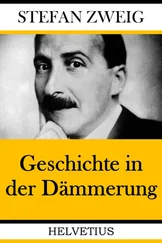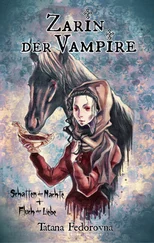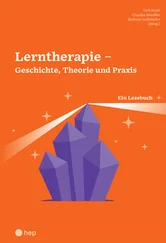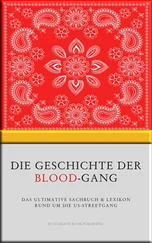9.5. Publikationen zu einzelnen Inseln
9.6. Zeitschriftenartikel
10. Bildnachweis
Vorwort
Dieses Buch zur Geschichte der Kapverdischen Inseln ist im Zusammenhang mit meiner Arbeit in der Stiftung «Bildung für Kinder in Afrika» (heute «Cabo Verde Stiftung für Bildung») entstanden. Neben der eigentlichen Projektarbeit bot sich mir bei den zahlreichen Besuchen des Archipels auch immer wieder Gelegenheit, mich mit der Geschichte dieses Landes auseinanderzusetzen. Eine besondere Faszination ging von der Tatsache aus, dass sich diese Geschichte in jeder Hinsicht von der mitteleuropäischen Geschichte unterscheidet und damit den Weg zu völlig neuen Sichtweisen öffnet und ungewohnte Zusammenhänge aufzuzeigen vermag. Cabo Verde war – um den von Jürgen Osterhammel geprägten Begriffen zu folgen – sowohl eine frühe Siedlungskolonie mit vorerst durchaus mittelalterlichen politischen Strukturen wie auch eine Stützpunktkolonie, die vor allem dem Sklavinnen- und Sklavenhandel diente.
Um die Zeit vom 15. bis zum 18. Jahrhundert zu verstehen, bildete die Lektüre der «História Geral de Cabo Verde» eine hervorragende Grundlage. Sie ist ein Musterbeispiel für eine moderne und differenzierte Historiografie eines afrikanischen Landes. Mit grösseren Schwierigkeiten war die Darstellung der Geschichte des Archipels im 19. und 20. Jahrhundert verbunden: Neben den auf Kap Verde und in Portugal eingekauften Publikationen erleichterte die Tatsache, dass viele neuere historische Dissertationen in Portugal über das Internet zugänglich sind, die Arbeiten an diesem Buch sehr. Der nationale und internationale Leihverkehr der Bibliotheken war zusätzlich eine grosse Hilfe. Auf Cabo Verde haben mich immer wieder Leute wie Victor Borges (früherer Koordinator der Schweizer Entwicklungsprojekte, Aussenminister des Landes 2004–2008) und António Leão Correia e Silva (Rektor der Universität Praia 2006–2010, Minister für höhere Bildung und Wissenschaft 2011–2016) bei der Recherche unterstützt, herzlichen Dank.
Ständige Begleiter beim Schreiben dieses Buches waren die positiven Erinnerungen an die vielen erfreulichen Begegnungen mit den Menschen auf Cabo Verde und in der Arbeit im Stiftungsrat in den letzten dreissig Jahren. Ich hoffe, das Buch vermöge zu einem vertieften Verständnis der Menschen auf dieser Inselgruppe beitragen.
Teil I: Allgemeine Geschichte des Archipels unter besonderer Berücksichtigung der Insel Santiago
1.Die Entdeckungsgeschichte der Kapverdischen Inseln im 15. Jahrhundert
1.1.Die portugiesischen Entdeckungsfahrten an der westafrikanischen Küste
Die Geschichte der Kapverdischen Inseln ist eng mit der Geschichte der Expansion Portugals verknüpft; nach dem heutigen Stand der Forschung war der Archipel vor den portugiesischen Entdeckungen nicht besiedelt. Es ist daher wichtig, kurz auf die wirtschaftlichen und politischen Hintergründe der portugiesischen Entdeckungs- und Handelsfahrten entlang der westafrikanischen Küste einzugehen.
Im Fernhandel zwischen den wichtigen Wirtschaftszentren Oberitalien und den Niederlanden spielte Portugal während des Hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich (1339–1453) eine zunehmend wichtigere Rolle. Die Kriegshandlungen führten zu einer Verlagerung des Fernhandels vom Land- auf den Seeweg. Für die Galeeren und Rundschiffe der führenden Handelsstädte Venedig und Genua waren die portugiesischen Häfen wichtige Zwischenstationen auf dem langen Weg vom Mittelmeer zur Nordsee.
Um 1400 war Portugal ein für die damalige Zeit «moderner» Territorialstaat mit starken zentralistischen Tendenzen. Zwischen dem handeltreibenden städtischen Bürgertum und dem Adel bestanden keine grossen Gegensätze, beide waren in der Ständeversammlung (Cortes) vertreten. Die muslimischen Herrscher spielten in Portugal seit der Eroberung der Algarve um 1250 keine Rolle mehr – ganz im Gegensatz zu Spanien, wo die Herrschaft des Kalifats Granada erst 1492 endete. Die Erbmonarchie des Hauses Avis (1383–1580) sorgte für Stabilität an der Spitze des Staates, nicht zuletzt dank der engen politischen Zusammenarbeit der Angehörigen des Königshauses. Portugal verfügte über eine Verwaltung, ein Rechts- und ein Finanzwesen auf schriftlicher Grundlage. Königliche Kommissare kontrollierten die städtischen oder adeligen Gerichte. Das Steuerwesen war zentralisiert, ein neuer Amtsadel stützte das Königshaus. 1
Der Friede von Alcácovas 1479 bereinigte die dynastischen und wirtschaftspolitischen Differenzen zwischen Kastilien und Portugal und legte die Staatsgrenzen für Jahrhunderte fest. Portugal erhielt dadurch einen weiten Spielraum für seine maritime Expansion.
Venezianische, genuesische und portugiesische Kaufleute beteiligten sich in den nordafrikanischen Häfen von Tunis, Bone, Alger, Oran, Ceuta, Tanger, Massa und Saffi am Handel mit dem Gold des Sudans, mit Gewürzen, sowie mit Sklavinnen und Sklaven aus Schwarzafrika. Zwei Drittel des europäischen Goldbedarfs wurden durch die Produktion im Sudan gedeckt. Die jährlichen Goldexporte von Afrika nach Europa betrugen etwa 6000 Kilogramm, während aus Südamerika später nur etwa 4000 Kilogramm stammten.
Neben Gold, Gewürzen, Sklavinnen und Sklaven war die Bekämpfung der Piraterie ein weiteres Motiv zur Eroberung der Hafenstadt Ceuta. 2Die Eroberung von Ceuta 1415 stellte den ersten Versuch Portugals dar, direkten Anschluss an den afrikanischen Goldhandel zu gewinnen. Wegen eines marokkanischen Bürgerkrieges war die militärische Lage günstig. An der Eroberung war auch Prinz Heinrich der Seefahrer beteiligt – eine der wenigen Seefahrten, die der Seefahrer tatsächlich unternommen hat. Neben Ceuta eroberten die Portugiesen später weitere Orte in Marokko, so Alcacer Ceguer (1458–1550), Arzila (1471–1550), Tanger (1471–1661) und im Süden Mazagão (1514–1769, arabisch El Jadida). Anfangs des 16. Jahrhunderts kamen noch fünf weitere Orte für wenige Jahrzehnte dazu. 3
Die Anfänge der portugiesischen Eroberungen in Afrika gehen also nicht auf den Versuch zurück, einen Seeweg nach Indien zu finden – wie dies häufig in Schulbüchern dargestellt wird. Es ging um den Anschluss an den afrikanischen Goldhandel.
Auch der Sklavenhandel spielte eine gewisse Rolle: Die Sklaverei war in Europa bis ins Spätmittelalter nie ganz verschwunden. Sklavinnen und Sklaven arbeiteten in den Hafenstädten Venedig und Genua in den Haushalten; in der Algarve, in Südspanien, in Süditalien und auf Sizilien auch in der Landwirtschaft, vor allem auf den Zuckerrohrplantagen. 4
Bereits nach 1422 begann Heinrich der Seefahrer Schiffe an die marokkanische Küste auszusenden und erreichte vorerst das Cabo Não (südlich des heutigen Agadir), 1434 das wegen seiner Untiefen, Strömungen und Stürmen gefürchtete Kap Bojador. Dies wurde erst mit vertieften Kenntnissen der Windsysteme und Strömungen zwischen dem afrikanischen Festland und den Kanarischen Inseln möglich. Zudem wurde in Portugal der Schiffstypus der Karavelle weiterentwickelt: Mit dem Lateinsegel konnte auch gegen den Wind gesegelt werden und das Steuerruder in der Mitte des Hecks erleichterte das Lenken des Schiffes. Da an der Atlantikküste des nördlichen Afrikas häufig ein Nordostpassat weht, waren diese technischen Voraussetzungen vor allem für die Rückfahrt nach Portugal wichtig.
1441 umfuhr Nuno Tristão das Cabo Branco (im heutigen Mauretanien, an der Grenze zur Westsahara) und nahm die ersten schwarzen Sklavinnen und Sklaven gefangen. 1444 erreichte er die Mündung des Senegalflusses.
Gomes Eanes de Azurara nannte 1448 in seiner «Chronik der Entdeckung und Eroberung von Guinea» fünf Gründe für die Entdeckungsfahrten der Portugiesen entlang der westafrikanischen Küste:
Читать дальше