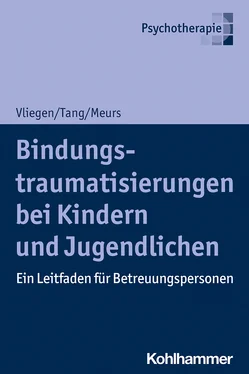2Wir sprechen in diesem Buch durchweg von einem »komplexen Trauma« oder einer »Bindungstraumatisierung«, was in der empirischen und klinischen Literatur auch als »Bindungstrauma« »frühes Beziehungstrauma« und »frühes Entwicklungstrauma« bezeichnet wird.
3Die oben beschriebenen Einsichten und Erkenntnisse haben wir von den vielen Autor*innen erhalten, die sich weltweit mit diesem Thema beschäftigen; wir haben ihre Erkenntnisse aufgearbeitet, integriert und in unserem eigenen Arbeitskontext angewendet. Aus Gründen der Lesbarkeit haben wir nur eine Auswahl an Literaturverweisen in den Text aufgenommen. Die Literaturliste enthält daher auch Quellen, die im Text nicht zitiert werden.
Entwicklung im Schatten eines komplexen Traumas
Wie frühe negative Lebenserfahrungen und Bindungstraumatisierungen ein junges Kind und sein Umfeld beeinflussen
Im ersten Teil betrachten wir, wie schwierige Erfahrungen im Kontext der Bindungsbeziehungen der ersten Lebensphase die Entwicklung eines Kindes beeinflussen können. Zudem gehen wir darauf ein, was dies für Pflegepersonen und neue Bindungspersonen sowie für ihr Umfeld bedeutet.
Im ersten Kapitel beschreiben wir zunächst, um welche Kinder es sich dabei konkret handelt und was Psychotherapie und Elternbetreuung für die Verletzungen, die diese Kinder früh in ihrem Leben erlitten haben, bedeuten kann und könnte.
Im zweiten Kapitel liefern wir Anknüpfungspunkte, um zu verstehen, was »Stress« im Leben eines sehr kleinen Kindes bedeuten kann und inwiefern permanente und verstärkte Stresserfahrungen die frühe Entwicklung beeinträchtigen und dadurch den biologischen Organismus eines jungen Kindes traumatisieren können. Zu diesem Zweck beginnen wir mit Hintergrundinformation über entwicklungspsychologische Aspekte. Diese kurze entwicklungspsychologische Einführung erleichtert es zu verstehen, was junge Eltern unter normalen Umständen alles unternehmen, um ihrem Kind einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, ohne sich dessen permanent bewusst zu sein. Anschließend wird erläutert, was es für ein Baby bedeutet, wenn eine »genügend gute« Versorgung – auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist – fehlt.
Im dritten Kapitel wird beschrieben, wie Kinder mit einem komplexen Trauma mit Entwicklungsaufgaben ringen und mit verschiedenen Hindernissen während ihrer Kindheit und im Erwachsenenalter konfrontiert werden, die die Entwicklung langfristig prägen können. Dabei kann es zu »eigenartigen« oder »andersartigen« Bindungs- und Persönlichkeitsentwicklungen kommen.
Im vierten Kapitel beschäftigen wir uns schließlich mit der Frage, wie (Pflege- oder Adoptiv-)Eltern und ein breites Betreuungsnetzwerk einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung von Kindern mit einem komplexen Trauma haben können. Die Erziehung von oder professionelle Hilfe für diese Kinder erfordert jedoch zuweilen viel von Eltern, Großeltern, Lehrer*innen, Erzieher*innen und anderen Begleiter*innen. Wir beschreiben, wie ein solches – »komplex traumasensibles« – Betreuungsnetzwerk den Wachstums- und Entwicklungsprozess eines Kindes mit einem komplexen Trauma, ausgehend von einem angemessenen Verständnis der Besonderheiten dieser Kinder, grundlegend unterstützen kann.
1 Außergewöhnliche Kinder, außergewöhnlicher Versorgungsbedarf

1.1 Jedes Kind ist anders
Louise ist 3 Jahre alt, als ihre Eltern für eine diagnostische Abklärung in unser Zentrum kommen. Sie selbst vermuten, dass Louise eine Bindungsstörung hat. Sie finden ihr Kind in der Beschreibung des »unersättlichen Kindes« (van Egmond, 1987; im Sinne von Kindern als ›ein Fass ohne Boden‹) wieder, die sie im Internet lesen: Egal was man für Louise auch macht, sie scheint unersättlich und niemals zufrieden zu sein.
Leonardo ist 8 Jahre alt. Zu Hause ist er aufsässig, unbeherrschbar und hat seinen Vater schon einmal so weit gekriegt, dass er die Zimmertür entfernt hat, weil Leonardo sie zeitweise laut zu geschlagen oder diese demoliert hat. Leonardo ist auch schon mal mit einem Messer auf seinen Bruder losgegangen, nachdem dieser ihn an seinen Schultern gepackt hatte. »Wir befürchten, dass er sich zu einem Problemfall entwickelt, der die Metros in Brüssel unsicher macht«, ist die ängstliche – aber vielleicht nicht einmal ungerechtfertigte – Vorstellung seiner Eltern. Sie sind ratlos.
Maya, 8 Jahre alt, hat immer wieder Wutausbrüche, die ihre Eltern überfordern. Es gibt Zeiten, in denen sie scheinbar ohne Grund in blinder Wut um sich schlägt und beißt. Die Eltern sind in großer Sorge.
Celine, 12 Jahre alt, fängt, sobald sie aus dem Auto aussteigen muss, an zu brüllen, sie schreit ihre Pflegeeltern an und beschimpft sie. Mit solchen Szenen bringt sie ihre äußerst fürsorglichen Pflegeeltern immer wieder in große Verlegenheit.
Die Eltern von Vreni, 14 Jahre alt, kommen zu uns und fragen um Rat, weil ihre Tochter zu Hause tagelang nicht gesprochen hat. Sie sitzt einfach wütend da und starrt vor sich hin und belastet so das familiäre Zusammensein. Sie schweigt dann stunden- sogar tagelang und sobald jemand versucht, mit ihr zu sprechen, schnauzt sie denjenigen an.
Wenn man den Eltern dieser Kinder zuhört, zeigt sich eine Vielzahl an Symptomen und Beschwerden, die die betroffenen Kinder aufweisen. Diese Kinder zeigen oftmals immense Verhaltensauffälligkeiten, die für ihre Umwelt sehr belastend sein können, und werden daher anfangs häufig wegen einer »Verhaltensstörung« behandelt. Sie haben Schwierigkeiten, ihr Verhalten zu kontrollieren und Emotionen zu regulieren – Fähigkeiten, die viele gleichaltrige Kinder bereits entwickelt haben. In bestimmten Situationen scheint es, als würde ihnen jegliche Kontrolle oder Regulierung fehlen. Zudem können kleine, unscheinbare Ereignisse in diesen Kindern schon viel auslösen.
Es gibt jedoch auch viele Situationen, in denen sich diese Kinder scheinbar gut im Griff haben und sich vorbildlich verhalten. Dadurch wird es für die Eltern dieser Kinder jedoch nicht gerade einfacher.
Wenn der Therapeut mit den Eltern und Lehrer*innen von Leonardo am Tisch sitzt, entsteht oft der Eindruck, als ob beide Parteien über ein gänzlich anderes Kind sprächen. Im Klassenzimmer sehen die Lehrer*innen ein Kind, das sein Bestes gibt, auch wenn dies oft nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Sie sind verwundert, wenn die Eltern über das äußerst schwierige Verhalten von Leonardo zu Hause reden, und haben Zweifel an den erzieherischen Kompetenzen der Eltern. Die Eltern fühlen sich aus diesem Grund oft von ihrem Kind manipuliert: »Wenn er will, kann er es. Wenn die Lehrerin neben ihm steht, dann begreift er, was ihm gesagt wird, aber wenn ich zu Hause dann mit ihm die Hausaufgaben mache, dann geht plötzlich gar nichts.«
»Wenn jemand von der Verwandtschaft da ist, weiß sie genau, wie sie sich zu benehmen hat. Aber sobald wir wieder mit ihr allein sind, bricht die Hölle aus und sie wird unendlich wütend. (…) Vreni, die tagelang zu Hause schweigt, kann bei anderen hingegen einen sehr umgänglichen Eindruck hinterlassen.«
Es wird dabei oft nicht erkennbar, dass diese Kinder ihr Möglichstes tun, um sich in der Schule oder bei Familienbesuchen zu behaupten, sich sehr anstrengen und ihr Bestes geben. Zurück in der gewohnten häuslichen Umgebung fallen dann jedoch alle Hemmungen weg und die Angst der Eltern bestätigt sich: »Na, da sieht man es: Nur bei uns verhält sie sich so schwierig.«
Er hatte eine sehr gute Taktik. In der Schule bemerkte man nichts, er gab sein Bestes. Als er nach Hause kam, war er dann aber komplett erschöpft. Er konnte keine Reize mehr ertragen, selbst das Telefon musste ausgeschaltet werden. Wenn jemand unerwartet ins Zimmer kam, wurde er hysterisch.
Читать дальше