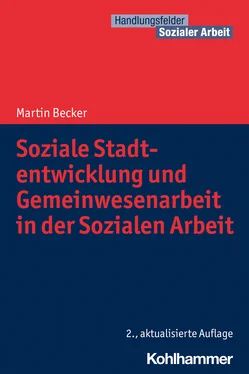Aus der Perspektive der mikrosoziologischen Phänomenologie (Schütz 1932) wird der subjektive Sinn sozialen Handelns in seiner Bezogenheit auf Situationen, Orte und Anlässe des Handelns als »lebensweltliche« Phänomene begrifflich festgehalten und ethnomethodologisch untersucht. Auch die auf Goffmann (1969) zurückgehende Interaktionsforschung macht den räumlichen Charakter sozialer Phänomene und damit deren vielfältige Beziehungen deutlich. Henri Lefèbvre sorgte in den 1970er Jahren für eine Wiederbelebung der theoretischen Debatte um Raum. In seiner kapitalismuskritischen Schrift »Die Produktion des städtischen Raums« entwickelte Lefèbvre (1977) einen relationalen Raumbegriff, der zwischen sozialem und physischem Raum unterscheidet. Raum wird nach Lefèbvre von jeder Gesellschaft in spezifischer Weise produziert. Dies geschieht z. B. durch die »räumliche Praxis«, also der (Re-)Produktion von Raum, durch die Aktivität der Wahrnehmung des Raums bzw. raumbezogene Verhaltensweisen. Mit der »Repräsentation von Raum« verbindet Lefèbvre die Konzeptualisierung von Raum durch Ideen z. B. von ArchitektInnen, PlanerInnen oder KünstlerInnen, die dem Raum eine kognitive Bedeutung und Lesart verleihen. Praxis und (Re-)Präsentation des Raums durchdringen einander und werden beeinflusst durch die gesellschaftliche Ordnung, die im Kapitalismus beispielsweise mit der Entfremdung des Handelns einhergehe. Den dritten Aspekt der Produktion von Raum sieht Lefèbvre im »Raum der Repräsentationen«, womit die Bedeutung von Symbolen für die Raumbestimmung gemeint ist. Damit verwirft Lefèbvre das Verständnis von Raum als Behälter oder absolutem Raum und will die Vielgestaltigkeit und Relationalität von Raum deutlich machen, ohne einen klaren Raumbegriff anbieten zu können.
Dieter Läpple (1991) griff die Diskussion um Raum in Deutschland wieder auf, indem er, im Gegensatz zu der bis dahin für die stadtsoziologische Forschung dominierenden sozialökologisch orientierten »Kölner Schule« um Jürgen Friedrichs (1977), die Verwendung von »Behälterkonzepten« kritisierte und stattdessen folgende vier Komponenten einer Raummatrix formulierte:
1. gesellschaftliche Verhältnisse als materielle Erscheinungsform,
2. gesellschaftliche Interaktions- und Handlungsstrukturen,
3. institutionalisiertes und normatives Regulationssystem,
4. räumliches Zeichen-, Symbol- und Repräsentationssystem.
Mit dieser Differenzierung machte er deutlich, dass Raum theoretisch rekonstruierbar und gesellschaftlich konstituiert wird, womit quasi eine Verständigungsnotwendigkeit über die jeweilige Bedeutung von Raum entsteht.
Martina Löw (2001) hat den raumsoziologischen Diskurs ein Jahrzehnt später weitergeführt und präzisiert, indem sie auf die Unterschiede der mit den Begriffen »Behälterraum« und »Beziehungsraum« verbundenen Konzepte hinwies. Demnach wird unter einem »Behälterraum« ein Gefäß (z. B. Saal oder Stadtteil) verstanden, das, aus dem Blickwinkel von außen nach innen betrachtet, mit Gegenständen, Menschen oder Eigenschaften (beispielsweise Möbel, Menschen, Gerüche etc. in einem Saal bzw. Gebäude, Straßen, Plätze, Menschen und Lärm in einem Stadtteil) gefüllt sein kann. Beim »Beziehungsraum« wird, von innen nach außen betrachtet, ausgehend von den »Gegenständen« (z. B. Menschen, Aktionen, physische Körper, Organisationen, Regeln, Weltbilder) das Ergebnis der Beziehungen zwischen diesen »Gegenständen« beschrieben. Zur Darstellung der Vielschichtigkeit und Vielgestaltigkeit der Dynamik von Räumen verwendet Löw den Begriff der (An-)Ordnung von Lebewesen und sozialen Gütern an Orten. Diese Schreibweise in Klammern soll verdeutlichen, dass Räume gleichermaßen auf der Anordnungspraxis und auf gesellschaftlichen Ordnungen beruhen. Räumliche Strukturen würden demnach durch, in Räume eingeschriebene, Regeln konstituiert und durch Ressourcen gesichert. Löw schlägt vor, von einer durch die Relation zwischen Strukturen und Prozessen geprägten doppelten Konstituiertheit von Raum auszugehen. Zur Analyse von Raumkonstitutionen brauche es demzufolge Kenntnisse der »Bausteine« (soziale Güter und Menschen) und deren Beziehungen untereinander. Hilfreich hierzu sei nach Löw ein Rahmenkonzept unter Verwendung eines »Raum-Zeit-Relativs«, womit im Forschungsprozess der Ausgangspunkt wahlweise auf den »Bausteinen« oder den Beziehungen liegen kann, solange beide Perspektiven einbezogen werden. Im ersten Fall, der vorrangigen Betrachtung der Strukturen, sind für Operationalisierungen, die materielle Gestalt, das soziale Handeln, die normative Regulation und die kulturellen Ausdrücke zu beachten. Aus dem Blickwinkel des Herstellungsprozesses von Raum sind nach Löw die beiden Prozesse »Syntheseleistung« und »Spacing« zu unterscheiden. »Syntheseleistung« meint das Schaffen von Räumen durch die Verknüpfung der Raumelemente (soziale Güter und Lebewesen) durch Menschen über Wahrnehmungs-, Erinnerungs- und Imaginationsprozesse. Unter »Spacing« wird der zweite Konstitutionsvorgang, das Platzieren von sozialen Gütern und Menschen und deren symbolischer Markierung, durch die deren Zusammenspiel kenntlich gemacht wird, verstanden. »Syntheseleistung« und »Spacing« geschehen im Alltag der Konstitution von Raum gleichzeitig. Löw geht »… (analytisch) von einem sozialen Raum aus, der gekennzeichnet ist durch materielle und symbolische Komponenten« (2001: 15). Räume sind für Löw, aufgrund der in hierarchisch organisierten Gesellschaften meist ungleichen und unterschiedlichen Bevölkerungsteile begünstigenden bzw. benachteiligenden Verteilung, oft Gegenstand sozialer Auseinandersetzungen.
»Verfügungsmöglichkeiten über Geld [ökonomisches Kapital wie Einkommen], Zeugnis [Kulturelles Kapital, wie Bildung], Rang [Status] und Assoziationen [Inklusion/Exklusion; Soziales Kapital] sind ausschlaggebend, um (An)Ordnungen durchsetzen zu können, so wie umgekehrt die Verfügungsmöglichkeit über Räume zur Ressource werden kann« (Löw 2001: 272) 10 .
Schroer (2006) verweist auf die etymologische Herkunft des Raumbegriffs von »räumen/abräumen/Platz schaffen« und erklärt damit die Bedeutung des ›Raum Schaffens‹ als sozialen Prozess. Mit Blick auf die historische Entwicklung der Rezeption des Begriffs konstatiert Schroer eine Veränderung von absoluten (Aristoteles, Newton, Kant) über relativistische (Leibniz, Einstein) zu relationalen Raum-Verständnissen (Elias, Lefèbvre, Löw). Schroer sieht »die besondere Bedeutung Simmels für eine Soziologie des Raums darin, dass er sowohl die strukturelle Seite des Raums betont als auch die Hervorbringung des Raums durch menschliche Aktivitäten« (2006: 78). Das Verdienst der Literaturwissenschaftler um Dünne und Günzel (2006) ist es, eine interdisziplinäre Übersicht der Theorien zu Raum erstellt und dabei eine wertvolle Sammlung von Originaltexten vom 17. Jh. bis in die Gegenwart zusammengestellt und kommentiert zu haben.
An folgendem kleinen Beispiel soll die Problematik skizziert werden: Man stelle sich eine Bushaltestelle in einem Stadt-(Rand-)Viertel vor, die mit einer einfachen Überdachung den Wartenden Schutz vor Niederschlägen und mit einer Bank Sitzgelegenheiten bietet. Materiell handelt es ich um einen baulichen Unterstand. Für NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsnetzes handelt es sich um einen Ort, an dem sie bis zur Ankunft des Busses mehr oder weniger kurze Wartezeiten verbringen und ansonsten keinen weiteren Nutzungsbedarf haben. PassantInnen mögen den Unterstand als günstig gelegenen Regenschutz beim zufälligen Vorübergehen ansehen und nutzen. Wohnungslose Menschen, die sich vorwiegend im öffentlichen Raum aufhalten, könnten diesen Ort als Wohn- oder Schlafraum ansehen und nutzen. Jugendliche könnten wegen fehlender finanzieller oder räumlicher Alternativen den Ort als Treffpunkt und Szeneort ihrer Clique ansehen und nutzen. In jedem der beschriebenen Beispiele bleibt der materielle Raum derselbe, während die Bedeutungszuschreibung aufgrund der unterschiedlichen Raumkonzepte, also der Vorstellungen, Bedeutungen, Handlungen und Symbole, ganz unterschiedlich ausfallen.
Читать дальше