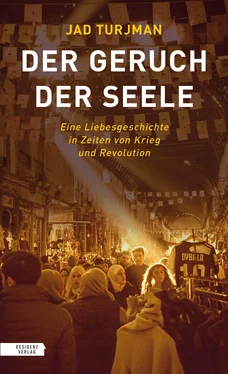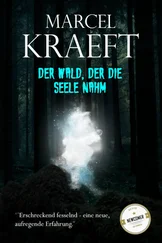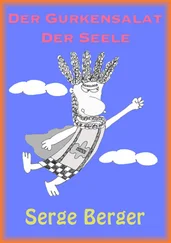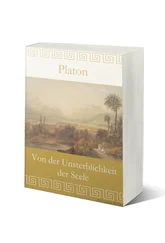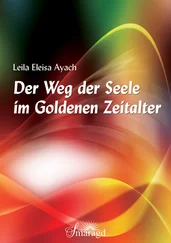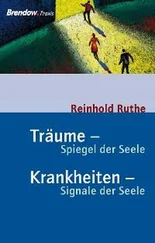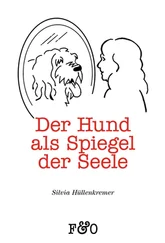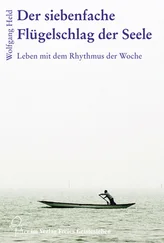»So, jetzt muss ich gehen. Meine Freundinnen warten draußen«, lächelt sie ihm zu, dreht sich um und geht. Tarek bleibt unbeweglich stehen und schaut ihr nach. Er blickt auf sein Handy und speichert die Nummer unter »Traumfrau«.
Dann läuft er schnell hinaus zu der Bank vor dem Fakultätsgebäude für Literatur, bei der er sich immer mit seinen Freunden trifft. In dem großen Garten gibt es mehrere Bänke, eine davon ist »ihre«, und ohne sich etwas auszumachen, finden sie sich immer dort. Tareks Freunde teilen seine kritische Haltung gegenüber dem Regime, und wenn sie unbeobachtet sind, drehen sich ihre Gespräche immer um Politik. Als er die Bank erreicht, sitzen dort schon Mohanad und Hibba, mit denen er seit Studienbeginn befreundet ist. Mohanad ist ein zuvorkommender blonder Syrer mit blauen Augen, der wie ein Skandinavier aussieht, dessen Familie aber schon seit Generationen in Damaskus lebt. Aber wer sich mit der Geschichte der Stadt auskennt, wundert sich nicht über das unterschiedliche Aussehen ihrer Menschen. Wenn Mohanad mit seinem breiten Damaszener Dialekt spricht, wirkt es wie ein synchronisierter Film, weil sein Aussehen nicht zu seiner Sprache passt. Hibba kommt aus Hama und lebt seit drei Jahren mit ihrem Bruder in einer der wilden Siedlungen am Rand von Damaskus, in denen ohne Planung drauflosgebaut wird und wo jeder sich selbst darum kümmern muss, sein Haus mit Strom und Wasser zu versorgen. Wegen der unzähligen Kabel für Strom und Telefon, die einander völlig willkürlich überschneiden, sieht man den Himmel kaum. Hibba ist wortgewandt und politisch sehr interessiert. Sie ist eine entschiedene Gegnerin der herrschenden Baath-Partei, denn ein Großteil der Familie ihres Vaters wurde 1982 in dem Massaker von Hama ermordet.
Tarek nähert sich der Bank mit Tanzschritten und einem Lied auf den Lippen. »Was ist los? Einen so glücklichen Tarek haben wir noch nie gesehen«, wundert sich Mohanad. »Sie hat mir ihre Nummer gegeben, sie hat mir ihre Nummer gegeben!« Hibba und Mohanad schauen ihn mit großen Augen an. »Sanaa?«, fragt Hibba.
»Ja, und ich habe sogar ihre Hand berührt«, sagt Tarek und tanzt weiter.
»Gratuliere! Aber du bist doch kein Höhlenbewohner, der noch nie eine Frau berührt hat«, wundert sich Mohanad.
»Das war keine Berührung, das war ein göttlicher Augenblick. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt!«, erklärt Tarek und betont seine Worte mit breiter Gestik.
»Ich freue mich für dich. Aber wie weit, glaubst du, wirst du mit ihr gehen? Du hast sicher nicht vergessen, welcher Konfession sie angehört!«, versucht Hibba, Tarek wieder auf den Boden zurückzuholen. Tarek zuckt die Schultern und antwortet nicht. »Sie ist Alawitin und die Tochter eines Hochrangigen. Wenn du mehr als eine Freundschaft willst, wirst du Unruhe auslösen. Alawiten geben nie einem Sunniten ihre Tochter zur Frau!«, setzt Hibba fort, und ihr Hass auf die Alawiten ist spürbar. »Jetzt zerstör doch nicht die Freude eines Verliebten, er muss sie ja nicht gleich heiraten!«, meint Mohanad. »Außerdem weiß jeder hier auf der Uni, dass der durchgeknallte Saker ständig Sanaas Nähe sucht. Die sind auch Alawiten, und Sanaas Vater wird seine Tochter sicherlich eher dem Sohn eines hohen Geheimdienstlers geben als dir«, wendet Hibba noch ein.
»Da hat Hibba zwar recht, aber jetzt hast du so lange auf diesen Moment gewartet und uns mit deinen Plänen gelöchert. Wir müssen feiern, dass du sie endlich angesprochen hast! Du lädst uns jetzt auf einen Tesqehe bei Buz-Al-Gedi ein!«, schlägt Mohanad vor. Das Restaurant Buz-Al-Gedi liegt in der Shaalan-Straße, nicht weit vom Universitätsgelände, und ist berühmt für traditionelle Damaszener Gerichte.
»Nicht nur Tesqehe , ich kaufe euch das ganze Restaurant!«, ruft Tarek überschwänglich.
»Und die Vorlesung?«, wendet Hibba ein.
»Komm, lass uns gehen. Professor Smail erzählt in der ersten Stunde ohnehin nur von den Problemen mit seiner Frau. Ich kaufe nachher in der Bibliothek eine Zusammenfassung der Vorlesung«, wischt Tarek Hibbas Einwand euphorisch zur Seite und geht bereits los.
Nur vom Denken an das köstliche Frühstück aus Kichererbsen und gebratenen Fladenbrotstücken in einer Soße aus Joghurt, Sesampaste und Zitronensaft läuft den dreien das Wasser im Mund zusammen. Sie verlassen das Gelände über den Weg des Jasmins, einen kurzen Pfad durch den Garten, an dessen beiden Seiten Jasminsträucher zu einem Tunnel zusammengewachsen sind. Es riecht intensiv nach den weißen Blüten, ein Geruch, der in die Seele eindringt und Tote wieder zum Leben erweckt.
Abu Khadeifa folgt Abu Faruk, der Sanaa mitgenommen hat, und sie steigen die Treppen hinauf. Die unteren Ebenen sind den Funktionären, hochrangigen Kämpfern und dem Gericht vorbehalten. In den oberen Stockwerken sind die Gefängnisse. Ganz oben sind die bedeutendsten Gefangenen untergebracht. Alle Gegner des IS wurden davon in Kenntnis gesetzt, damit dieses Gebäude vor Luftangriffen geschützt ist. Am Treppenabsatz zum vierten Stock müssen die Männer zurückbleiben. »Du weißt, dass der vierte Stock den Frauen vorbehalten ist«, sagt ein Wärter, der den Eingang zum Frauenbereich bewacht. Abu Khadeifa ist kurzzeitig irritiert. »Mich beschäftigt etwas, ich bin mir über die Identität dieser Frau nicht sicher«, stottert er. Dann fasst er sich und setzt fort: »Ich muss mit Um Baakr über den Vorfall reden und ihr von meinen Zweifeln berichten. Meine Beobachtungen werden ihr bei der Befragung sicher helfen.« Der Soldat schaut ihn zweifelnd an. »Bleibt hier stehen, ich hole sie«, erklärt er und verschwindet hinter der großen Tür. Der Zutritt zum Frauenbereich ist für alle Kämpfer ausnahmslos verboten. Vor dieser strikten Regelung gab es massive Probleme, weil immer wieder Kämpfer um bestimmte Frauen gestritten haben.
Nach einigen Minuten öffnet sich die Tür und eine Frau in Uniform geht auf Abu Khadeifa zu. »Was willst du mir sagen?«, fragt sie mit ihrer tiefen, fast männlich klingenden Stimme und baut sich vor ihm auf. Abu Khadeifa tritt einen Schritt zurück. So wie alle anderen Kämpfer hat er Scheu vor Um Baakr. Sie ist ungefähr vierzig, ihr Gesicht ist durch eine Brandnarbe entstellt, eine Augenbraue fehlt, der Mund ist verzogen. Alle haben Respekt vor ihr, nicht wegen ihrer etwas beängstigenden Erscheinung, sondern weil sie als erste Frau im IS eine wichtige Funktion bekam und Alleinherrscherin über das vierte Stockwerk ist.
In diesem Gerichtsgebäude werden alle straffällig gewordenen Frauen und insbesondere die Sabaya festgehalten und auf die nächstmögliche Ehe vorbereitet. Sabaya sind Frauen anderer Religionen, die im Krieg »erbeutet« wurden. Der IS bestimmt sie als Sklavinnen für die Kämpfer. Besonders gilt das für Jesidinnen und Alawitinnen. Christinnen haben die Möglichkeit, Algesia zu zahlen, Tribut, Steuer, um ihren Glauben behalten zu dürfen. Für arme Christinnen beträgt diese Algesia einhundert Euro, das ist viel Geld, reiche hingegen werden mit sechshundert Euro besteuert. Christen werden als »Träger des Heiligen Buches« gesehen, daher ist diese Religion anerkannt. Jesiden, Alawiten wie auch Schiiten gelten als Abtrünnige und haben nur die Wahl, sich zum »richtigen« Islam zu bekennen oder getötet zu werden. Die Frauen aber können versklavt werden und dürfen an Kämpfer für ungefähr 1500 Euro – das entspricht dem Preis einer Kalaschnikow – verkauft werden.
»Es ist wegen dieser Frau«, erklärt Abu Khadeifa fast unterwürfig. »Wir haben ihr Gepäck und ihre Papiere an der Sicherheitskontrolle untersucht. Und nichts deutet darauf hin, dass sie Alawitin ist. Aber die Frau, die im Bus neben ihr saß, hat uns nachdrücklich versichert, dass sie an der Grenzstelle von einem Regime-Söldner erkannt und mit dem Namen ›Sanaa‹ angesprochen wurde. Sie hat den Söldner gebeten, mit ihr kurz den Bus zu verlassen, und ist nach einigen Minuten wieder eingestiegen. Das schien der Frau neben ihr verdächtig und sie hat versucht, auf dem Handy mitzulesen. Dabei hat sie festgestellt, dass diese Sanaa Alawitin ist.«
Читать дальше