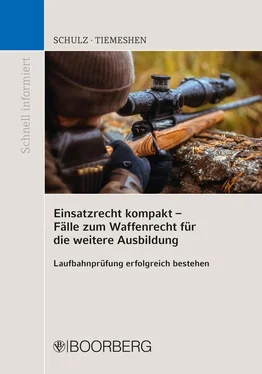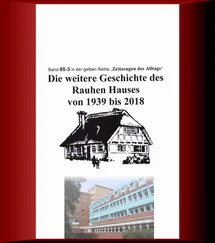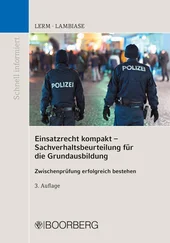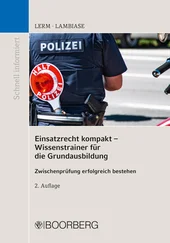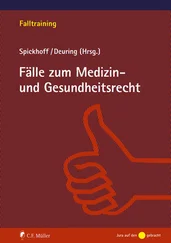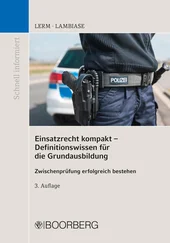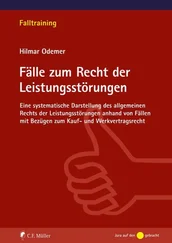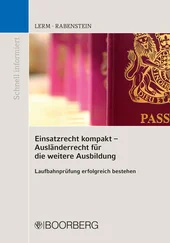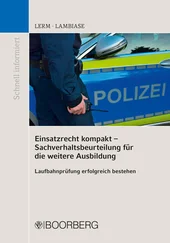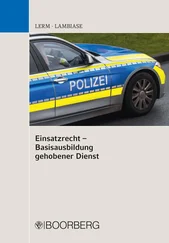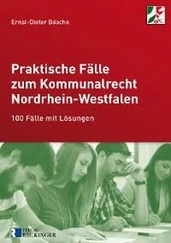Als letztes Element dieses Prüfungspunktes wird die Ausweispflichtgeprüft. Wer in Deutschland eine Waffe führt, muss die in § 38 WaffG aufgelisteten Dokumente mit sich führen. Als Merkformel gilt:
Wer eine Waffe führt, muss seinen Personalausweis und die für die beabsichtigten Umgangsformen benötigten Erlaubnisse mit sich führen.
Raum für eigene Notizen:
Dieser Prüfungspunkt stellt i. d. R. den Abschluss der waffenrechtlichen Prüfung dar. Hier werden die speziellen Situationen beleuchtet, in denen sich eine Person befinden kann. Es kann demnach vorkommen, dass bis hierhin kein waffenrechtlicher Verstoß vorliegt, sich aber aus den jeweiligen Gegebenheiten ein solcher ergeben kann. Für die Fallbearbeitung in der Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst werden hier hauptsächlich die §§ 42 und 42a WaffG relevant.
In beiden Normen wird ein Führungsverbot für bestimmte Waffen in bestimmten Situationen dargestellt.
Gem. § 42 Abs. 1 WaffG ist es generell untersagt, sämtliche Waffen bei öffentlichen Vergnügungen, Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Märkten oder ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen zu führen. Auch wenn die jeweilige Erlaubnis für ein Führen vorläge, dürfte man dennoch die Waffe nicht bei diesen Anlässen führen.
Beispiel:
Eine Person (P) hat eine Pistole und besitzt für diese eine Waffenbesitzkarte (WBK) und einen Waffenschein. P wird auf einer Demonstration im Hamburger Hauptbahnhof angetroffen. P ist 20 Jahre alt und führt neben den Erlaubnissen auch seinen Personalausweis mit.
P hat die für den Umgang (Erwerb/Besitz und Führen) erforderlichen Erlaubnisse. Außerdem ist er mindestens 18 Jahre alt und führt die Erlaubnisse sowie seinen Personalausweis mit sich. Demnach sind zunächst alle Voraussetzungen für einen erlaubten Umgang vorhanden. Da sich P jedoch auf einer Demonstration und damit auf einer öffentlichen Veranstaltung befindet, ist ihm gem. § 42 Abs. 1 WaffG das Führen der Pistole nicht gestattet.
Den häufigsten Anwendungsfall in einer Klausur oder auch in der Praxis stellt der § 42a WaffG dar. Im Gegensatz zu § 42 Abs. 1 WaffG wird hier nicht auf bestimmte Veranstaltungen abgestellt. Vielmehr untersagt der § 42a Abs. 1 WaffG generell das Führen von Anscheinswaffen, Hieb- und Stoßwaffen nach Anl. 1 Abschn. 1 UA 2 Nr. 1.1 oder Messern mit einhändig feststellbarer Klinge (Einhandmesser) oder feststehende Messer mit einer Klingenlänge über 12 cm. Demzufolge dürfen diese Gegenstände außerhalb der eigenen Wohnung oder des eigenen befriedeten Besitztums nicht mitgeführt werden (vgl. Definition der Umgangsform Führen). Anscheinswaffen sind in Anl. 1 Abschn. 1 UA 1 Nr. 1.6 WaffG definiert. Vereinfacht ausgedrückt sind dies Gegenstände, die Schusswaffen optisch gleichen. Wichtig für die Anwendung des § 42a Abs. 1 WaffG sind die dort genannten Messer. Für Gegenstände, die als Hieb- und Stoßwaffe bestimmt sind wie beispielsweise Schwerter oder Kampfmesser, ist die Nr. 2 einschlägig. Das Führverbot des § 42a WaffG erfasst aber auch Messer, die keine Waffen i. S. d. WaffG sind.
Ein Einhandmesser ist demzufolge ein Messer, das bauartlich so geschaffen ist, dass sich die Klinge mit nur einer Hand aufklappen lässt. Der dafür vorgesehene Mechanismus ist nicht speziell festgelegt. Entscheidend ist vielmehr, dass eine Sperrvorrichtung existiert, die die Klinge nach dem Aufklappen daran hindert, von allein zurück zu klappen. Im Gegensatz dazu sind die Klingen der sog. feststehenden Messer nicht versenkbar oder auf andere Weise einklappbar.
Für dieses Führverbot gibt es auch im § 42a WaffG speziell geregelte Ausnahmen, die sich in § 42a Abs. 2 Nrn. 1–3 WaffG finden. Die ersten beiden Nummern im Absatz 2 gelten für alle aufgeführten Waffen (Anscheinswaffen, Hieb- und Stoßwaffen, Einhandmesser und Messer mit feststehender Klinge über 12 cm). Die Anscheinswaffen sind für die Ausnahme der Nummer 3 ausgenommen. Nach § 42a Abs. 2 Nr. 1 WaffG gilt das Führverbot nicht für die Verwendung bei Foto-, Film-, oder Fernsehaufnahmen oder Theateraufführungen. Ebenfalls als Ausnahme des Führverbots gilt der Transport in einem verschlossenen Behältnis gem. § 42a Abs. 2 Nr. 2 WaffG. Ein solcher Transportsetzt jedoch einen Anfangs- und einen Zielpunkt voraus, weshalb ein bloßes „immer dabeihaben“ nicht als Transport gilt. Ein Behältnisi. S. d. Vorschrift ist ein Raumgebilde, welches zur Aufnahme von Sachen dient und nicht dazu bestimmt ist, von Menschen betreten zu werden. Beispiele für solche Behältnisse sind u. a. eine Aktentasche oder ein Koffer. Um sich auf die Ausnahme nach § 42a Abs. 2 Nr. 2 WaffG berufen zu können, muss das Behältnis jedoch verschlossen sein. Verschlossen bedeutet hier abgeschlossen.
Verschlossene Behältnisse sind unter anderem:
• Verschließbare Aktentasche
• Abgeschlossenes Handschuhfach
• Rucksack, soweit der Reißverschluss durch ein Schloss gesichert ist
Zuletzt besteht ebenfalls eine Ausnahme vom Führverbot des § 42a Abs. 1 WaffG, wenn ein berechtigtes Interessegem. § 42a Abs. 2 Nr. 3 WaffG vorliegt. Der Begriff des berechtigten Interesses wird im § 42a Abs. 3 WaffG näher erläutert. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die dort vorgenommene Aufzählung nicht abschließend, sondern beispielhaft ist.
Ein berechtigtes Interesse liegt unter anderem im Zusammenhang mit der Berufsausübung vor. Es ist daher zu bejahen, wenn der mitgeführte Gegenstand zur Ausübung des Berufes benötigt wird und das Führen in einem zeitlich-räumlichen Zusammenhang mit der Tätigkeit steht. Der Hin- und Rückweg zur Arbeitsstätte ist damit auf jeden Fall von der Ausnahme erfasst. Für folgende Berufsgruppen kommt eine Ausnahme vom Führverbot im Zusammenhang mit der Berufsausübung in Betracht: Metzger, Köche, Handwerker, etc. Ein klassischer Anwendungsfall ist der Handwerker, der sein Teppichmesser (Einhandmesser) für die Berufsausübung bei sich trägt.
Das berechtigte Interesse ist ebenfalls im Rahmen der Brauchtumspflege oder im Zusammenhang mit dem Sport gegeben. Ein Beispiel für die Brauchtumspflege sind Ritterlager (Schwerter, Dolche etc.). Für das Führen im Zusammenhang mit dem Sport muss die Waffe – ähnlich wie bei der Berufsausübung – für die jeweilige Sportart benötigt werden. Dies ist insbesondere bei Tauchern der Fall, die ein Einhandmesser mit sich führen, um dieses im Notfall unter Wasser mit einer Hand öffnen zu können.
In § 42a Abs. 3 WaffG wird zuletzt der allgemein anerkannte Zweck als berechtigtes Interesse benannt. Dies ist ein unbestimmter Begriff und bedarf der weiteren Auslegung. Gleichwohl können viele Tätigkeiten unter einen solchen Zweck subsumiert werden.
Beispiel:
Der 50-jährige H wird am Bahnhof Altona angetroffen. Er trägt offensichtlich Arbeitskleidung und hat ein Teppichmesser (Einhandmesser) bei sich. Auf das Messer angesprochen, gibt er an, er sei Handwerker und gerade auf dem Weg zur Arbeit. Das Messer benötigt er für seine Tischlerarbeiten.
Ein Teppichmesser stellt keine Waffe i. S. d. WaffG dar, da es nicht zur Herabsetzung/Beseitigung der Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen bestimmt ist. Es unterliegt dennoch dem Führverbot des § 42a Abs. 1 WaffG. Da H laut Sachverhalt ein Handwerker ist und dieses Messer für die Berufsausübung benötigt, kommt eine Ausnahme gem. § 42a Abs. 2 Nr. 3 WaffG in Betracht. Das Führen des Messers erfolgt im Zusammenhang mit der Berufsausübung, welche nach § 42a Abs. 3 WaffG einen allgemein anerkannten Zweck darstellt. Folglich unterliegt das Messer in diesem Fall nicht dem Führverbot und der H darf das Teppichmesser in der Öffentlichkeit führen.
Читать дальше